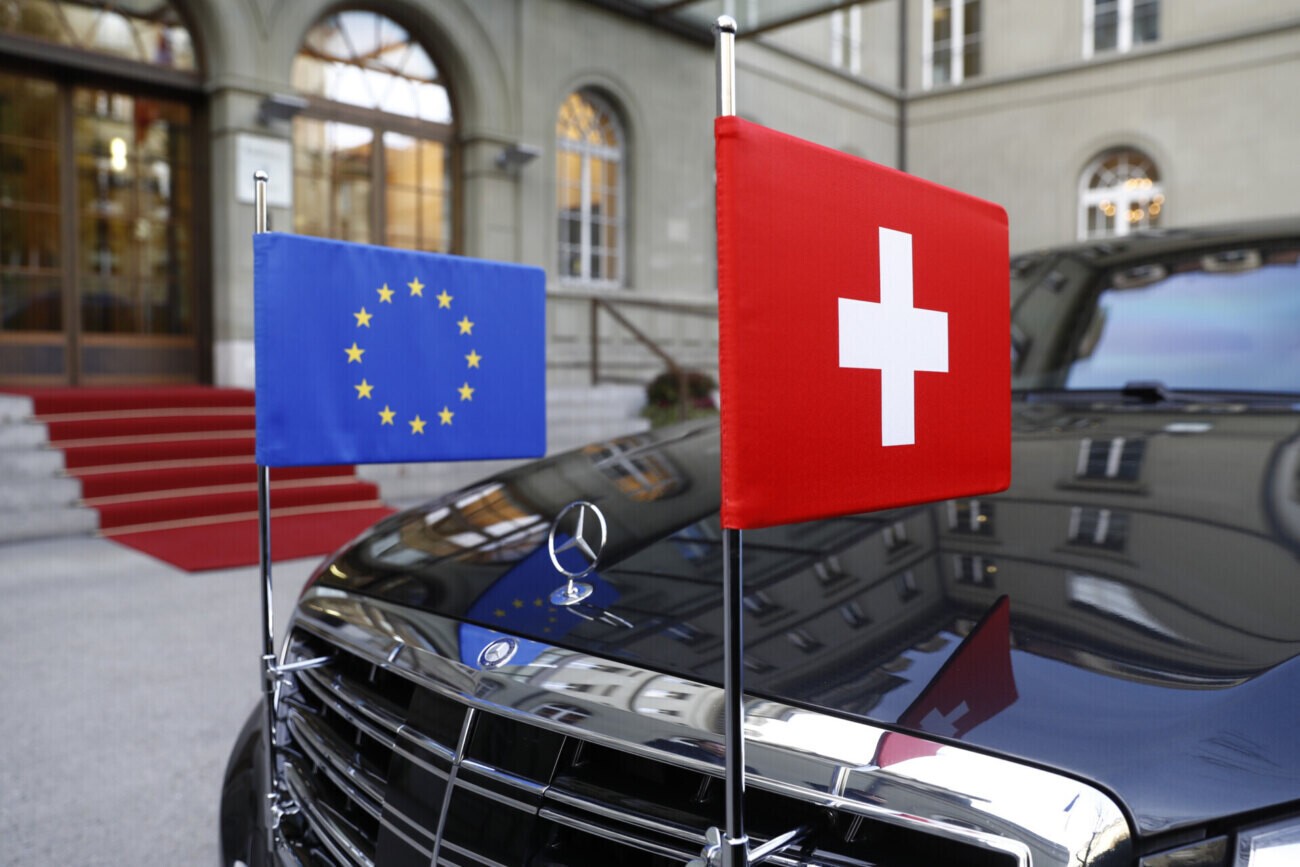Der Franken hat sich abgeschwächt, der Aufschwung kommt – und Nationalbankkritiker Daniel Lampart wird mehrheitsfähig. Das wird ein gutes Jahr!

DANIEL LAMPART: «In der Schweiz klafft die Einkommensschere weit auseinander.» (Foto: Yoshiko Kusano)
work: Daniel Lampart, Sie haben die Aufhebung des Frankenmindestkurses durch die Nationalbank vor drei Jahren von Anfang an scharf kritisiert. Damals allein auf weiter Flur. Inzwischen geben Ihnen immer mehr Experten recht: Es war ein grosser Fehler. Wie ist das, wenn man als Gewerkschaftsökonom plötzlich mehrheitsfähig wird?
Daniel Lampart: Mehrheitsfähig sind wir noch nicht ganz. Aber es zeigt sich jetzt halt, wie gravierend die Folgen dieser Mindestkursaufhebung sind: Zehntausende Arbeitsplätze gingen verloren, der Druck auf Löhne und Personalkommissionen in den Betrieben war sehr hoch. Entscheidend für uns wird jetzt sein, wo der Franken sich in Zukunft hinbewegt.
Sie sind kein bisschen stolz, dass Sie von Anfang an vor dieser Entwicklung gewarnt hatten?
Nein, wie sollte ich auch! Für mich war das schlimm mit anzusehen.
«Dieser Aufschwung gehört den Arbeitnehmenden.»
Selbst der neoliberale Ökonom Franz Jaeger gab Ihnen kürzlich in einer Studie* recht, welche die Unia mit in Auftrag gegeben hatte. Ohne Frankenschock, sagt er, hätten wir heute 100’000 Arbeitsplätze mehr. Ist diese Schätzung realistisch?
In Deutschland sind seit 2009 allein in der Maschinenindustrie fast 20 Prozent zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden. Bei uns dagegen ging fast jeder zehnte Arbeitsplatz verloren. Das bedeutet klar: Ohne die Frankenüberbewertung hätten wir in der Exportwirtschaft eindeutig ein Beschäftigungsplus.
Inzwischen ist der Franken weicher geworden, der Wechselkurs zum Euro liegt aber immer noch unter 1.20. Reicht das?
Wir sind froh über diese Entwicklung. Aber nein, das reicht nicht. Ein wirklich fairer Frankenkurs läge zwischen 1.25 und 1.35.
Fordern Sie einen neuen Mindestkurs?
Für uns entscheidend ist, dass wir jetzt möglichst in die Nähe von 1.25 bis 1.35 kommen werden. Wir erwarten, dass die Nationalbank die Zinsen tief hält und weiterhin interveniert, damit sich der Franken noch mehr abschwächt. Einen neuen Mindestkurs fordern könnte man schon, nur hat die Nationalbank dieses Instrument schlechtgeredet, so dass es schwierig wäre, es glaubwürdig wiedereinzuführen. Was wir aber verlangen, ist eine kritische Bilanz der Geldpolitik der Nationalbank der letzten zehn Jahre: Was hat sie gebracht, was versäumt? Und wir fordern eine Nationalbankpolitik, die an den Devisenmärkten wieder klar vermittelt, wo sie den Franken haben will – und wo nicht. Eine Politik, die für einen stabilen, fairen Frankenkurs steht. So, wie das vor der starken Aufwertung 2009 war.
Sehen Sie Möglichkeiten, dieses Ziel von 1.25 bis 1.35 ohne Mindestkurs zu erreichen?
Solange die Zinsen auf dem Franken weniger attraktiv sind als jene auf dem Euro, das heisst insbesondere, solange wir in der Schweiz Negativzinsen haben, sollte sich der Franken tendenziell abwerten. Aber es kann auch immer anders kommen, denn die Devisenmärkte sind sehr nervös bis hysterisch.
Was bedeutet der heute bessere Wechselkurs Franken-Euro für die Schweizer Exportfirmen?
Sie haben mehr Spielraum und Geld – auch für Lohnerhöhungen. Kommt dazu, dass die weltweite Konjunktur klar anzieht. Der Aufschwung hat inzwischen auch die Schweiz erreicht. Wichtig ist nun, dass er auch bei den Arbeitnehmenden ankommt. Und zwar in allen Branchen. Wir fordern deshalb: höhere Löhne, tiefere Arbeitszeiten und sicherere Arbeitsplätze.
Was heisst das konkret für die Löhne?
Die Kader und Spezialisten zocken weiterhin ab, die Zahl der Einkommensmillionäre steigt, aber die Löhne der Normalverdienenden hinken hinterher. In der Schweiz klafft die Einkommensschere weit auseinander. Das erfordert jetzt eine klare Korrektur: Lohnsenkungen ganz oben und Lohnanstieg bei den unteren und mittleren Löhnen.
Um wie viel also sollen die Löhne steigen?
Wir verlangen generelle Lohnerhöhungen von 1,5 bis 2 Prozent. Die Lohnverhandlungen sind derzeit noch im Gange. Eine erste Bilanz zeigt: Einzelne Industriebetriebe haben in diesem Rahmen abgeschlossen. Doch die Nullrunde, die die Baumeister wollen, die geht natürlich überhaupt nicht. Die Baubranche läuft gut, Lohnerhöhungen liegen auch dort absolut drin.
«Wir fordern höhere Löhne und tiefere Arbeitszeiten.»
Und um wie viel müssen die Arbeitszeiten sinken?
Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Landesstreik. Eine der Errungenschaften dieses Landesstreiks war die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von etwa 59 Stunden auf 48 Stunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg sanken die Arbeitszeiten weiter. Doch dieser Prozess kam in jüngerer Zeit zum Erliegen, wir haben seit einigen Jahren sogar Arbeitszeiterhöhungen. Dies, obwohl die Produktivität weiterhin steigt. Ein Teil dieser Arbeitszeiterhöhungen war krisenbedingt. Sie betrafen übrigens nicht nur die exportorientierten Branchen wie die Maschinenindustrie, sondern gingen querbeet und betrafen auch den Finanzsektor, die Informatik und andere. Dazu kamen Arbeitszeiterhöhungen wie etwa beim Kanton Luzern: Als Folge von Steuersenkungen lässt man dort das Staatspersonal pro Woche neu statt 42 Stunden 43,25 Stunden arbeiten. Jetzt im Aufschwung müssen all diese Arbeitszeiterhöhungen schnellstens gesenkt werden. Orientierungsgrösse ist und bleibt die 40-Stunden-Woche.
Die Nationalbank sitzt auf einem Riesenvermögen von 800 Milliarden Franken in Aktien, Anleihen und Goldbarren. Ist dieses Geld Volksvermögen?
Das Vermögen der Nationalbank ist grundsätzlich die Folge der Interventionen am Devisenmarkt. Anleger aus dem In- und Ausland haben viele Franken gekauft. Die Nationalbank gehört mehrheitlich den Kantonen. So gesehen ist es auch öffentliches Vermögen. Die Geldpolitik hat aber Priorität. So kann es sein, dass dieses Vermögen aus geldpolitischen Gründen auch wieder liquidiert werden muss.
Trotzdem, die Nationalbank ist schwer reich. Zum Vergleich: Die 300 Reichsten der Schweiz besitzen laut Wirtschaftsmagazin «Bilanz» nur 674 Milliarden Franken …
… ja, es ist beachtlich. Ohne Aufhebung des Mindestkurses wäre das Nationalbankvermögen wohl nicht so hoch.
«Ein fairer Frankenkurs liegt bei 1.25 bis 1.35.»
Könnte man also sagen, dieser Vermögensberg sei der Blutzoll für die Arbeitsplatzschlächterei, die unter dem Frankenschock stattgefunden hat?
Nein. Wenn die Nationalbank nicht interveniert hätte, wäre die Situation für die Arbeitnehmenden noch viel schlimmer.
Norwegen hat viel Öl, und die Schweiz hat viele Franken. Norwegen legt das Geld aus den Ölverkäufen in einem Staatsfonds an. Mit gutem Gewinn für die Allgemeinheit. Jetzt fordern verschiedene Persönlichkeiten, auch die Schweiz sollte ihre Nationalbankgewinne oder einen Teil davon in einem Staatsfonds anlegen. Oder in einem Aktienfonds. Oder in einem Industriefonds (siehe Box rechts). Einverstanden?
Ich gebe hier gerne meine Einschätzung zu geldpolitischen Fragen der Nationalbank. Über die Zusammensetzung der Nationalbankbilanz kann ich als Bankrat der Nationalbank aber nicht öffentlich Stellung nehmen. Denn hierzu entscheidet der Bankrat mit. Deshalb nur kurz: Am wohlsten ist mir, wenn der Franken eine langweilige Währung ist, die die Spekulanten nicht interessiert. Das hilft der Allgemeinheit am meisten.
Zurück zum Aufschwung, wie nachhaltig wird er?
Konjunkturprognosen sind wie Wetterprognosen – also schwierig. Und die Geldpolitik bleibt natürlich weiterhin ein Risiko. Aber wir sehen im In- und Ausland: die Investitionstätigkeit nimmt zu, und die Arbeitslosigkeit nimmt ab. Die Kaufkraft steigt. Wir rechnen, dass das Bruttoinlandprodukt 2018 um rund 2,5 Prozent wächst. Und dass die Arbeitslosenquote von 3,1 auf 2,8 Prozent sinkt. Das wäre zwar kein gewaltiger Aufschwung, aber ein spürbarer. Es geht aufwärts! Und wie gesagt: Dieser Aufschwung gehört den Arbeitnehmenden. Sie schaffen den Wohlstand in unserem Land – und nicht die Finanzakrobaten und Abzocker auf den Teppichetagen.
Braucht die Schweiz einen Staatsfonds?
Die Nationalbank hat die Lizenz zum Frankendrucken. Mit diesen Franken interveniert sie an den Devisenmärkten. Seit der Aufhebung des Mindestkurses vor drei Jahren hat sie heftig interveniert und 200 Milliarden Franken gedruckt, um den überbewerteten Franken zu schwächen. Diese Art von Geldpolitik hat dazu geführt, dass die Nationalbank jetzt auf einem Vermögen von 800 Milliarden Franken in Aktien, Anleihen und Goldbarren sitzt (siehe Interview mit SGB-Chefökonom Lampart). Das ist massiv. Zum Vergleich: Die 300 Reichsten in der Schweiz haben ein geschätztes Vermögen von 674 Milliarden Franken («Bilanz»). Die Nationalbank ist also schwerer als alle in der Schweiz ansässigen Superreichen zusammen.
VORBILD NORWEGEN. Es geht um 800 Milliarden Volksvermögen. Wenn dieses Nationalbankvermögen oder Teile davon vergleichbar gut in einem Staatsfonds angelegt würden, wie Norwegen das mit seinen Gewinnen aus den Ölverkäufen macht, müsste der Ertrag pro Jahr bei etwa 6 Prozent liegen. Kein Wunder, nimmt die Zahl der Befürworterinnen und Befürworter eines solchen Fonds auch hierzulande zu. Ein Überblick:
Die Zahl der Befürworter nimmt zu.
UBS-Chefökonom Daniel Kalt würde die 800 Milliarden bei der Nationalbank belassen. Da diese das Geld gut anlege. Die Erträge allerdings sollen in einen «helvetischen Staatsfonds» fliessen. Das wären für 2017 54 Milliarden. Immerhin. Damit liesse sich einiges machen. Schon lange für einen Staatsfonds ist der SVP-Bahnunternehmer Peter Spuhler. Wie er diesen ausgestalten will, hat er bisher nicht im Detail ausformuliert.
SP-Politiker und Ökonom Rudolf Strahm schlägt einen ausgelagerten National-Anlagefonds vor, den man mit einem guten Teil der 800 Milliarden speisen könnte. Wichtig für ihn: Das Geld soll nicht als «Selbstbedienungsladen für Budgetpolitiker» gebraucht werden. Der St. Galler Ökonom Franz Jaeger empfiehlt die Schaffung eines strategischen Investitionsfonds für KMU durch die Nationalbank.
Einen sozialpartnerschaftlichen Produktionsfonds will Unia-Industriechef Corrado Pardini (work berichtete). Dieser soll den Industriestandort Schweiz stärken. Die SP-Politikerin und Ökonomin Susanne Leutenegger Oberholzer würde der Nationalbank mindestens 500 Milliarden wegnehmen und aus den Erträgen des so geschaffenen Staatsfonds die AHV sanieren und Krankenkassenprämien verbilligen. 2017 reichte sie dazu eine Motion ein. (mjk)