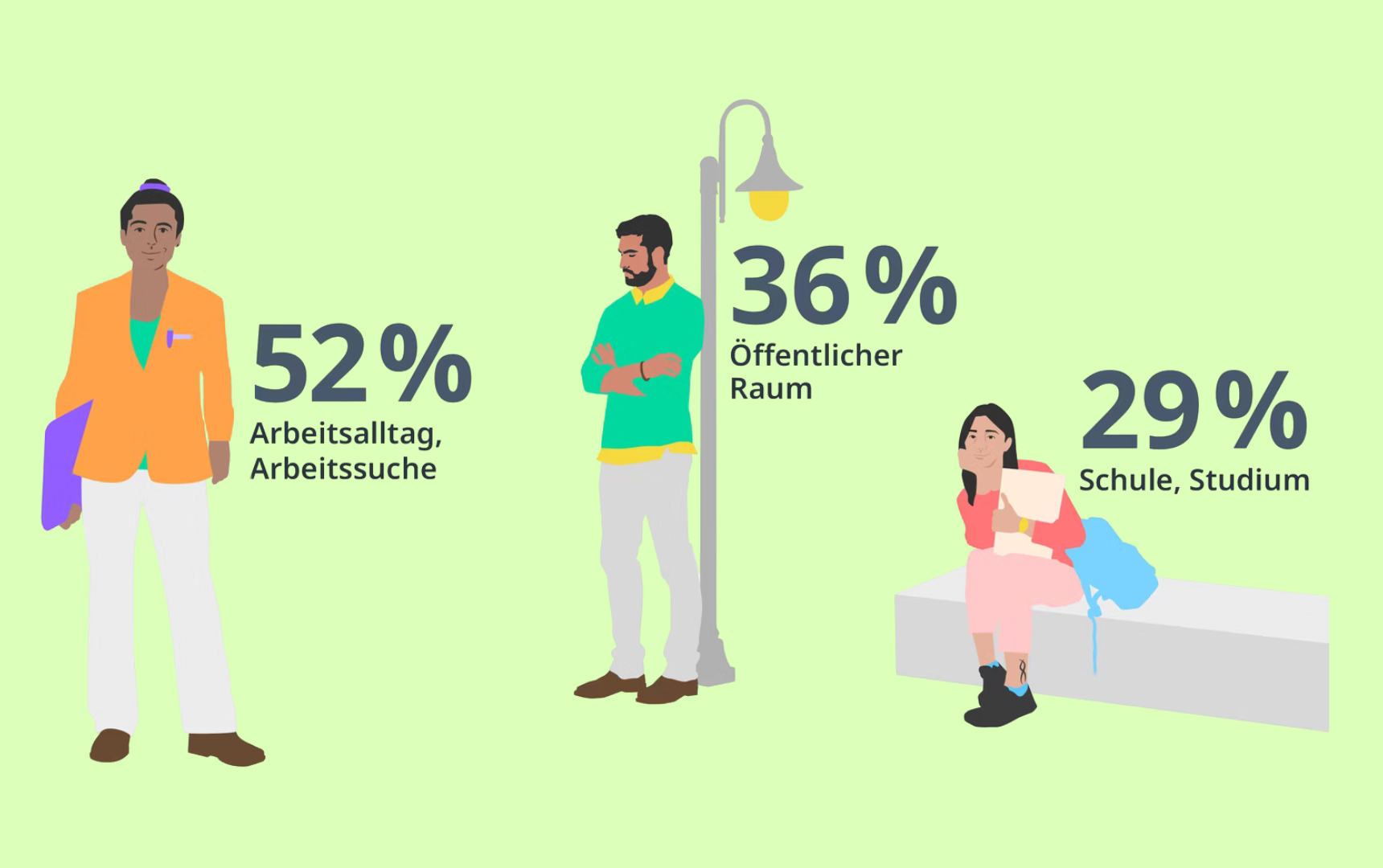Keine Festanstellung, unsicheres Gehalt, kein Schutz im Krankheitsfall: Die Situation vieler Lohnabhängiger in Deutschland ist dramatisch.

MISSTÖNE: Selbst gut ausgebildete Musiklehrerinnen und -lehrer kommen in Deutschland kaum über die Runden, obwohl sie fast pausenlos unterrichten. Ein Kind im Saxophon-Unterricht. (Foto: Keystone)
Gut ausgebildet und schlecht bezahlt sind sie beide, sowohl Alexandra als auch Richard (beide Anfang 40). Das Ehepaar, das in einer deutschen Kleinstadt lebt, arbeitet für Musikschulen, gibt zudem private Musikstunden. Beide haben ein Studium absolviert, gehen ihrer Arbeit mit Begeisterung nach. Und müssen sich trotzdem abstrampeln, um überhaupt auf je 1600 Euro Lohn zu kommen.
«1300 Euro zahlen sie im Monat für Zinsen, Tilgung, Strom, Wasser und die Ölheizung. Zum Glück ist lange nichts kaputtgegangen. Zum Glück liess die Bank mit sich reden, als Richard krank war und sie die Rate nicht zahlen konnten. Zum Glück fiel ihre Ölheizung unter den Bestandsschutz für Altbewohner und muss trotz Klimabedenken nicht ausgetauscht werden. Und wenn die Glückssträhne reisst? ‹Müssen wir noch mehr arbeiten›, hatte Alexandra am Telefon gesagt. ‹Was sollen wir machen?›»
«Sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten ist schwieriger geworden.»
NUR NOCH KLEINE TRÄUME
Die Passage stammt aus dem neuen Buch «Working Class». Darin folgt Autorin Julia Friedrichs Menschen wie Alexandra und Richard. Oder dem U-Bahn-Reiniger Sait. Und lässt Marktforscher Christian zu Wort kommen, dessen Firma ihn fast in den Tod getrieben hätte. Entstanden ist so ein detailliertes Bild des grösser werdenden Anteils der Arbeitnehmenden in Deutschland, deren Existenz an befristeten Arbeitsverträgen oder unzuverlässig gezahlten Honoraren hängt.
Autorin Friedrichs geht einem Bruch in Deutschland nach oder, wie sie es schreibt, den «vielen kleinen Rissen». Noch bis in die 1980er Jahre konnten weite Teile der Bevölkerung einen sozialen Aufstieg erleben. Auch ungelernte Tätigkeiten seien vergleichsweise gut bezahlt worden, viele hätten bescheidene Rücklagen bilden können. Doch diese Zeit sei vorbei, so Friedrichs. «Sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten ist schwieriger geworden, insbesondere für die, die heute unter 45 sind.»
Sait ist so einer. Seit fast 20 Jahren reinigt er die Berliner U-Bahnhöfe und schafft es dennoch nur auf einen Lohn von 10,56 Euro pro Stunde. Denn Sait ist nicht bei den Berliner Verkehrsbetrieben angestellt, die die Bahnhöfe betreibt, sondern bei einem der diversen Subunternehmen. Und so werden ihm Tarifvertrag, regelmässige Lohnerhöhungen und Schmutzzulagen vorenthalten. Für die staatsnahen Verkehrsbetriebe ist das eine saubere Sache: niedrigere Kosten und keine Verantwortung für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Für Sait und seine Kollegen bedeutet es hingegen ein Leben am Existenzminimum. Und so sind auch seine Träume geschrumpft. Danach gefragt, welcher Lohn seiner Wunschvorstellung entsprechen würde, antwortet Sait bescheiden: «Zwischen 12 und 13 Euro müsste man schon bekommen.»
Oder Rüdiger. Er war früher Verkäufer in der Warenhauskette Karstadt. Über ihn erfährt man, dass ihm schon die Umbenennung der Läden in «Galeria Karstadt Kaufhof» zuwider war, schliesslich stehe nun «sein Unternehmen» an zweiter Stelle. Und so denkt der «Karstädter» noch, als sich das Unternehmen längst gewandelt und auch ihn ausgelagert hat.
MAHNMAL FÜR DIE SCHWEIZ
Wenn Autorin Friedrichs so nah an ihren Protagonistinnen und Protagonisten dran ist, ist «Working Class» am stärksten. Dem stehen aber lange Passagen gegenüber, in denen eine unüberblickbare Zahl an Studien zitiert wird. Eine grafische Aufbereitung der Daten hätte den Zahlenreihen gutgetan. Und auch eine stärkere Zurückhaltung der Autorin, die als Ich-Erzählerin durchs Buch führt, wäre wünschenswert gewesen.
Denn tatsächlich ist «Working Class» nicht nur eine sehr interessante Beschreibung der sich verändernden Arbeitswelt. Das Buch ist auch ein Plädoyer dafür, «den Kapitalismus vor sich selbst (zu) retten», ihn «zurück in die Realwirtschaft» zu holen und von Exzessen zu befreien. Und an diesen Stellen führt Friedrichs bisweilen in die Irre. Etwa wenn sie gut einen Drittel des Texts dem Generationenkampf widmet und ihrer eigenen Wut Ausdruck verleiht, «die Alten» hätten sich auf Kosten «der Jungen» bereichert. Die Schlussfolgerungen, auf die sie so kommt, könnten direkt vom Arbeitgeberverband stammen: Rente mit 70, Streichen von Zuschüssen usw.
Lesenswert ist «Working Class» dennoch. Und indem es die Verhältnisse in Deutschland so eingehend beleuchtet, kann es der Schweiz als Mahnmal dienen. Man denke nur an Temporärarbeit, Outsourcing, Sparpakete, Franchising-Modelle und wie die modernen Scheusslichkeiten alle heissen.
Julia Friedrichs: Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Berlin-Verlag, CHF 32.90.