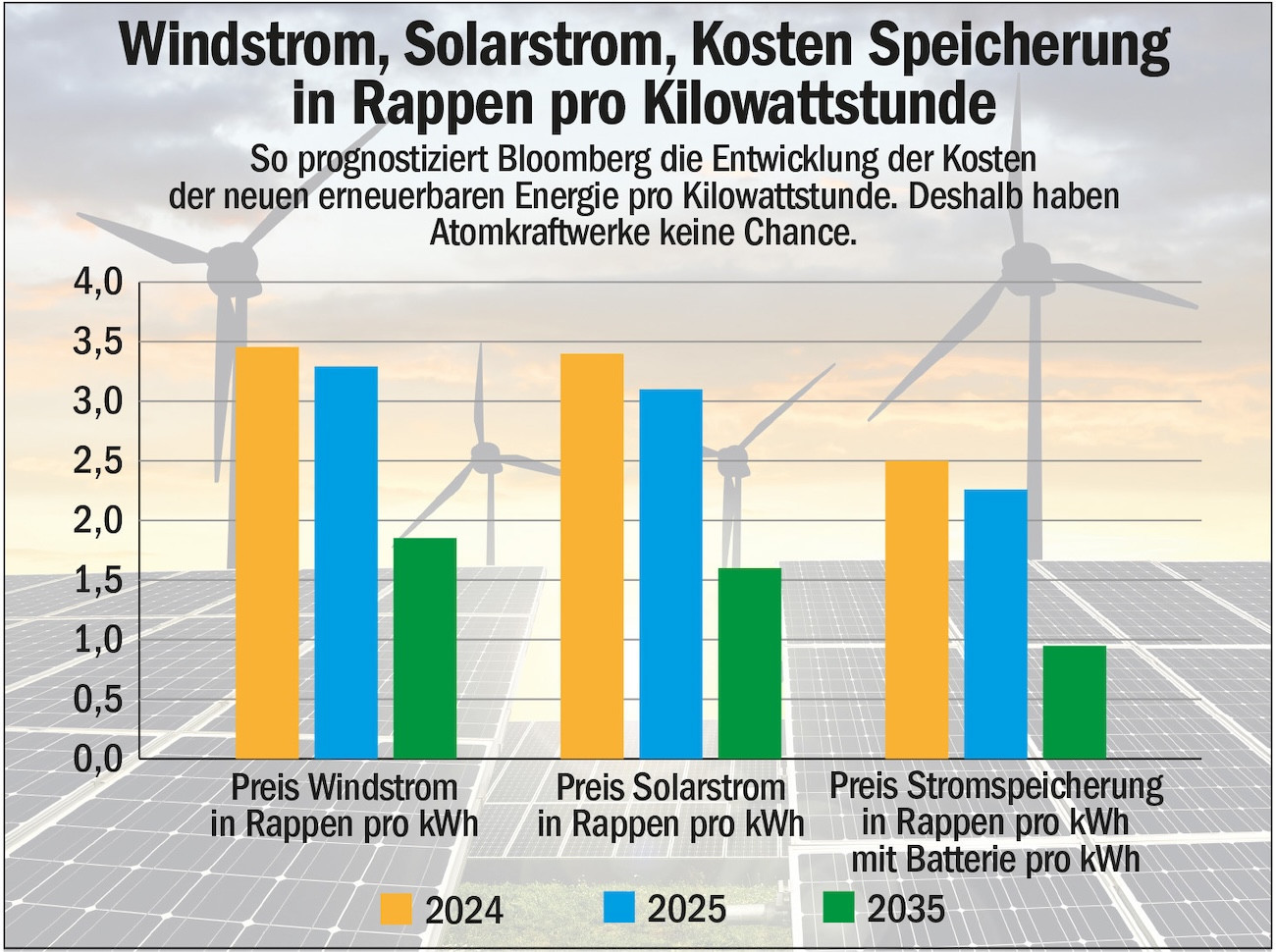Der Pharma-Kapitalismus funktioniert völlig chaotisch. Das zeigt das neue und brisante Buch «Die CureVac-Story». Verstaatlichungen wären zwar eine Alternative, aber sie brauchten globale Regeln. Deshalb müssten Linke und Gewerkschaften national und international eine Strategie entwickeln. Ein Vorschlag.

Die CureVac-Story: Das neue und brisante Buch von Wolfgang Klein zeigt romanhaft auf, wie chaotisch der Pharma-Kapitalismus heute funktioniert. (Foto: ZVG)
Frage an unsere Leserinnen und Leser: Welche zwei Unternehmen verwöhnen ihre Aktionärinnen und Aktionäre weltweit mit den höchsten Dividenden? Die Antwort: Roche und Novartis. Pro Jahr streicht ihr Sofa-Aktionariat nicht weniger als 13 Milliarden Franken ein.
Und zweite Frage: Wie viel kostet die Entwicklung eines neuen, wirksamen Medikaments? Die Schätzungen gehen bis zu 3 Milliarden Franken. Verglichen mit den Dividenden von Roche und Novartis würde dies also bedeuten, dass allein diese beiden Konzerne pro Jahr zusätzlich 4 neue und wirksame Medikamente auf den Markt bringen könnten.
Die bestbezahlen Manager und die bestverwöhnten Aktionäre weltweit haben in der laufenden Coronakrise leider kläglich versagt. Sie entwickelten allein oder mit Dritten keine Impfstoffe. Ihre teuren Schnelltests sind so was von unbrauchbar. Und von wirksamen Medikamenten kann bisher keine Rede sein.
GLOBALE REGELN. Noch nie haben sich so viele Menschen für die Pharmaindustrie interessiert wie heute. Noch nie wurde so klar, dass die Welt ein Dorf ist und dass alle Menschen Anspruch auf halbwegs gleichzeitige Impfungen haben müssten. Auch im Interesse der Reichen und Superreichen.
Damit alle Menschen weltweit geimpft wären, brauchte es 15 Milliarden Impfdosen. Auch wenn diese durchschnittlich 10 Franken kosten, würde dies weniger ausmachen als einen Viertel der jährlichen Verteidigungsausgaben der USA.
Das neue und brisante Buch «Die CureVac-Story» zeigt gar romanhaft auf, wie chaotisch der Pharma-Kapitalismus heute funktioniert. Verstaatlichungen wären zwar eine Alternative, aber sie brauchten globale Regeln. Deshalb müssten Linke und Gewerkschaften national und international eine Strategie entwickeln. Ein Vorschlag dazu zwecks Anregung einer überfälligen Diskussion:
Standbein 1: Alle Länder investieren 1 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts (BIP) in medizinische Forschung und Entwicklung. Würde für die Schweiz rund 7 Milliarden Franken pro Jahr ausmachen. Das würde die Arbeit von 35 000 Forschenden finanzieren.
Standbein 2: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) würde die Forschungsschwerpunkte festlegen. Wir brauchen unbedingt Antibiotika, die gegen heute resistente Keime wirken. Genau wie Medikamente, die Alzheimer-Erkrankungen stoppen. Mindestens die Hälfte der staatlichen Gelder müssten in solche Schwerpunktprojekte fliessen.
Standbein 3: Alle Erfindungen würden patentiert. Parallel dazu aber alle Resultate aller Forschungsarbeiten laufend offengelegt. Die WHO würde die Patente verwalten
und vernünftige Nutzungsgebühren festlegen.
Standbein 4: Neue Medikamente müssten umgehend weltweit in genügenden Mengen verfügbar sein. Und die Preise aufgrund der Kaufkraft der jeweiligen Länder abgestuft werden. Die Grössenordnungen: Das BIP pro Kopf ist im westafrikanischen Land Burkina Faso 70 Mal tiefer als in der Schweiz. Die WHO würde in diesem Prozess zur globalen Preisüberwacherin mutieren.
Utopisch? Vielleicht. Sicher aber konzeptionell mit viel Luft nach oben. Faktisch haben die Staaten ja weitgehend die Entwicklung und Produktion vorab der mRNA-Impfstoffe finanziert. Trotzdem fliessen die Gewinne nicht zurück an die Staaten, sondern in die Taschen der Aktionärinnen und Aktionäre der Pharmamultis. Das muss nicht weiterhin so bleiben.
Links zum Thema:
rebrand.ly/alzheimer-medikament
Die US-amerikanische Medikamenten-Zulassungsbehörde FDA hat erstmals seit 19 Jahren ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Wirkt es wirklich? Die Ansichten sind geteilt. Das Biogen-Medikament soll pro Jahr und Patientin oder Patient absurde 50 000 Franken kosten. Der absehbare Umsatz jährlich 5 bis 10 Milliarden Franken betragen. Nur die Reichen und Superreichen werden sich diese Therapie leisten können.
BRÖSMELI. Die entscheidenden Erfindungen für dieses Medikament wurden an der staatlichen Universität Zürich gemacht. Sie hat diese patentieren lassen. Und hofft, dass sie so 2 Prozent des Umsatzes rückerstattet bekommt. Das würde pro Jahr 100 bis 200 Millionen Franken ausmachen. Genau so darf es nicht weitergehen. Die Brosamen für den
Staat, die Sahnetorten fürs Aktionariat.