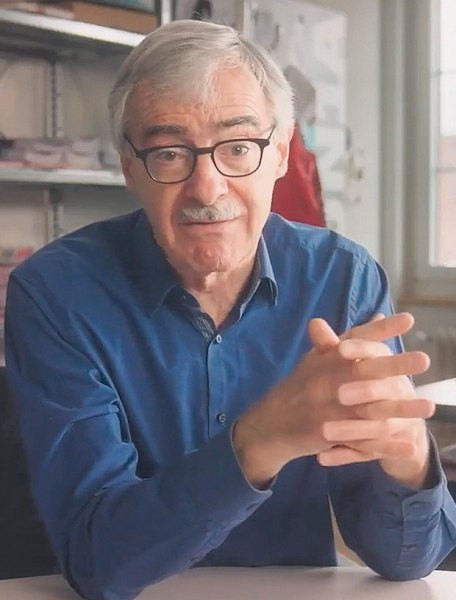«Auszeichnung» für KnausrigkeitDer geizigste Verband: Walliser Plattenlegerbosse halten die Löhne tief
Die Unia Wallis hat zum zweiten Mal in Folge den Verband der Walliser Plattenlegerchefs mit einer Raspel «ausgezeichnet». Der Preis ist kein Lob, sondern ein Mahnfinger für knausrige Arbeitgeber.