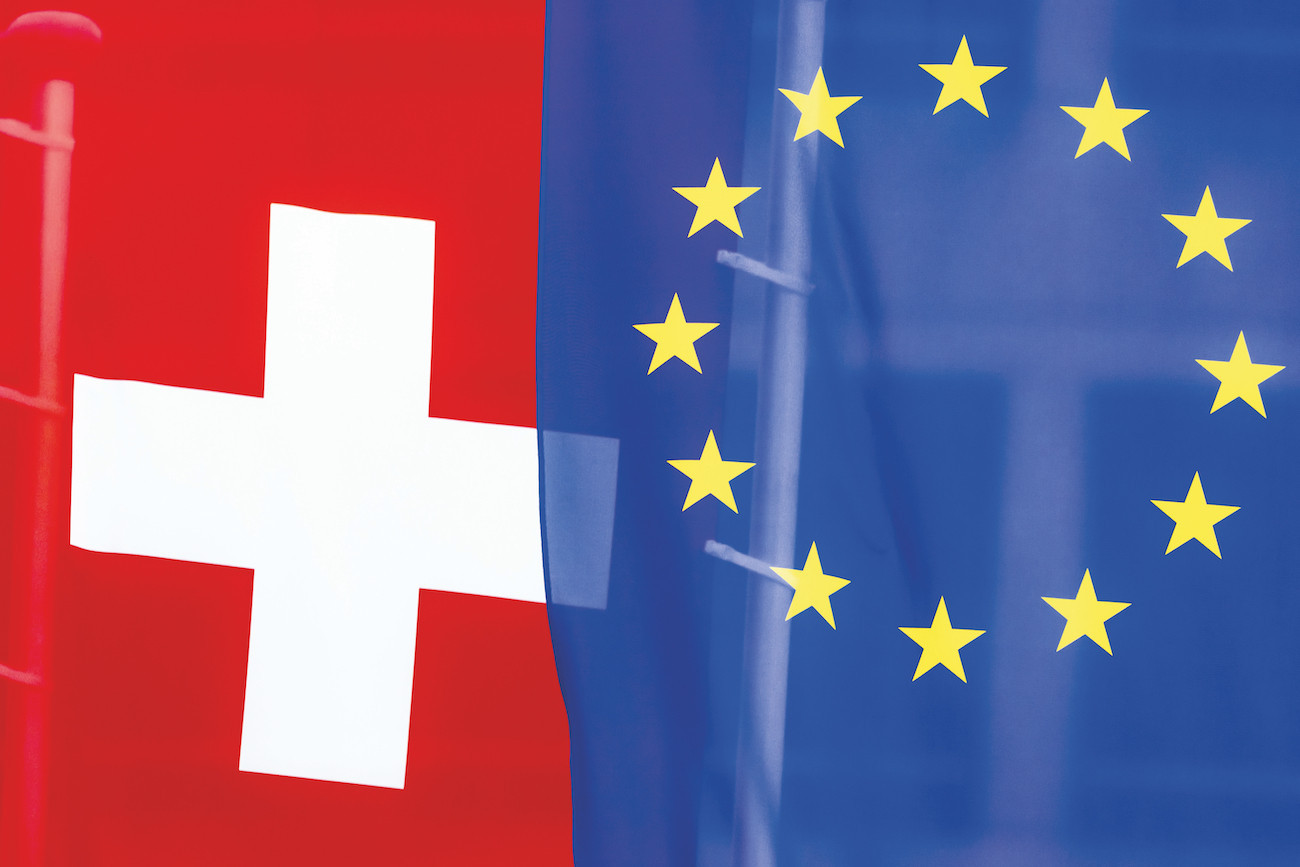Und die Gewerkschaften haben keine Fehler gemacht?
Wir haben uns offenbar zu viel bieten lassen. Und wir waren wohl nicht schnell genug: Wir haben es jedenfalls nicht geschafft, rechtzeitig für den Teuerungsausgleich zu mobilisieren, als die Teuerung einsetzte. Das müssen wir jetzt nach und aufholen.
Haben Sie die Wucht der Teuerung unterschätzt?
Es ist immer schwierig, solche Teuerungsschübe im voraus zu erkennen. Der aktuelle war stark mit dem Ukrainekonflikt und verschiedenen seiner Folgeeffekten verbunden. Das ist aber gar nicht der entscheidende Punkt. Wir verhandeln schliesslich nicht auf Basis von Prognosen. Doch wenn die Teuerung einmal da ist, muss sie ausgeglichen werden. Als Gewerkschaft müssen wir lernen: Sobald sich an der Teuerungsfront etwas verändert, braucht es sofort eine andere Präsenz. Das ist sicher eine wichtige Lehre aus den letzten Jahren: Unsere gewerkschaftliche Präsenz in der Lohnfrage muss noch stärker werden.
Nach den Lehrbüchern der bürgerlichen Ökonomie müsste die Verhandlungsposition der Arbeitnehmenden angesichts des viel beklagten Fachkräftemangels eigentlich sehr gut sein.
Korrekt! Und tatsächlich sind Arbeitskräfte gesuchter, und einzelne bekommen auch mehr Lohn. Teilweise verdienen jüngere, die neu in ein Unternehmen kommen, fast gleich viel wie ihre erfahreneren Kolleginnen und Kollegen, die ihnen die Arbeit beibringen müssen.
Mit welchen Auswirkungen auf das Betriebsklima?
Das führt verständlicherweise zu Unmut und schlechter Stimmung. Das ist ein Problem, das die Arbeitgeber unterschätzen. Aber wir verhandeln in erster Linie für diejenigen, die bereits im Betrieb sind, nicht für Neueinsteigende. In einer Phase wie dieser ist es klar unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich der Arbeitskräftemangel auch in höheren Löhnen niederschlägt. Aber wir sind dabei auf die Arbeitgeber angewiesen. Wenn die sich partout weigern, dann müssen wir ihnen erst einmal beibringen, dass sie kooperieren müssen.
Und wie?
Das gewerkschaftliche Repertoire ist sehr breit gefächert. Es beginnt mit klaren Forderungen und gut vorbereiteten Verhandlungen. Am Ende steht dann irgendwann der Streik. Aber zwischen konstruktiven Verhandlungen und Streik gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Das reicht von koordinierten Gesprächen einzelner Arbeitnehmender mit ihren Vorgesetzten über die Abstimmung zwischen verschiedenen Firmen, in denen verhandelt wird, bis hin zu Protestpausen. Ich denke, wir müssen von diesem Repertoire wieder stärker Gebrauch machen, ohne gleich zum Streik greifen zu müssen. Aber auch dies können.
Was passiert eigentlich, wenn die Kaufkraft der breiten Schichten weiter sinkt?
Die unmittelbare Folge ist klar: Es geht den Menschen schlechter. Sie arbeiten gleich viel, vielleicht sogar mehr, haben aber weniger Geld zum Leben. Aber es hat auch politische und gesamtwirtschaftliche Folgen.
Haben Sie Beispiele?
Wenn man sehen will, wie sich das anfühlt, gibt es zwei sehr anschauliche Beispiele grosser Länder. Zum einen die USA, wo die Mittelschicht in vielen Regionen regelrecht erodiert ist – sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor. Es gibt dort Superreiche und Gutsituierte, aber auch unzählige Menschen mit finanziellen Problemen. Das führt zu unerträglichen Zuständen mit entsprechenden politischen Auswirkungen. Zum anderen Deutschland. Hier sehen wir, dass eine grosse Volkswirtschaft in einer schwierigen konjunkturellen Situation steckt – einfach weil die Löhne mit der Teuerung und der Entwicklung der Lebenshaltungskosten nicht Schritt gehalten haben. Wir Gewerkschaften wollen auch dafür sorgen, dass es in der Schweiz nicht so weit kommt.
In den offiziellen politischen Debatten scheint die Kaufkraft der grossen Mehrheit ein kleines Problem zu sein. Lieber sprechen die bürgerliche Mehrheit und der Bundesrat vom kurz vor dem Bettelstock stehenden Bund. Und streicht möglichst alles zusammen, was den Anschein hat, sozial zu sein oder ökonomisch ausgleichend. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Wenn die Bevölkerung abstimmt, zeigt sich, dass soziale Fortschritte durchaus möglich sind. Das ist sehr positiv. Aber wir haben eine Regierung und ein Parlament, das sehr weit weg von der Bevölkerung politisiert. Neu ist, dass wir zum ersten Mal meistens ein 4-zu-3-Verhältnis von FDP und SVP gegen Mitte und SP in unserem Bundesrat haben.