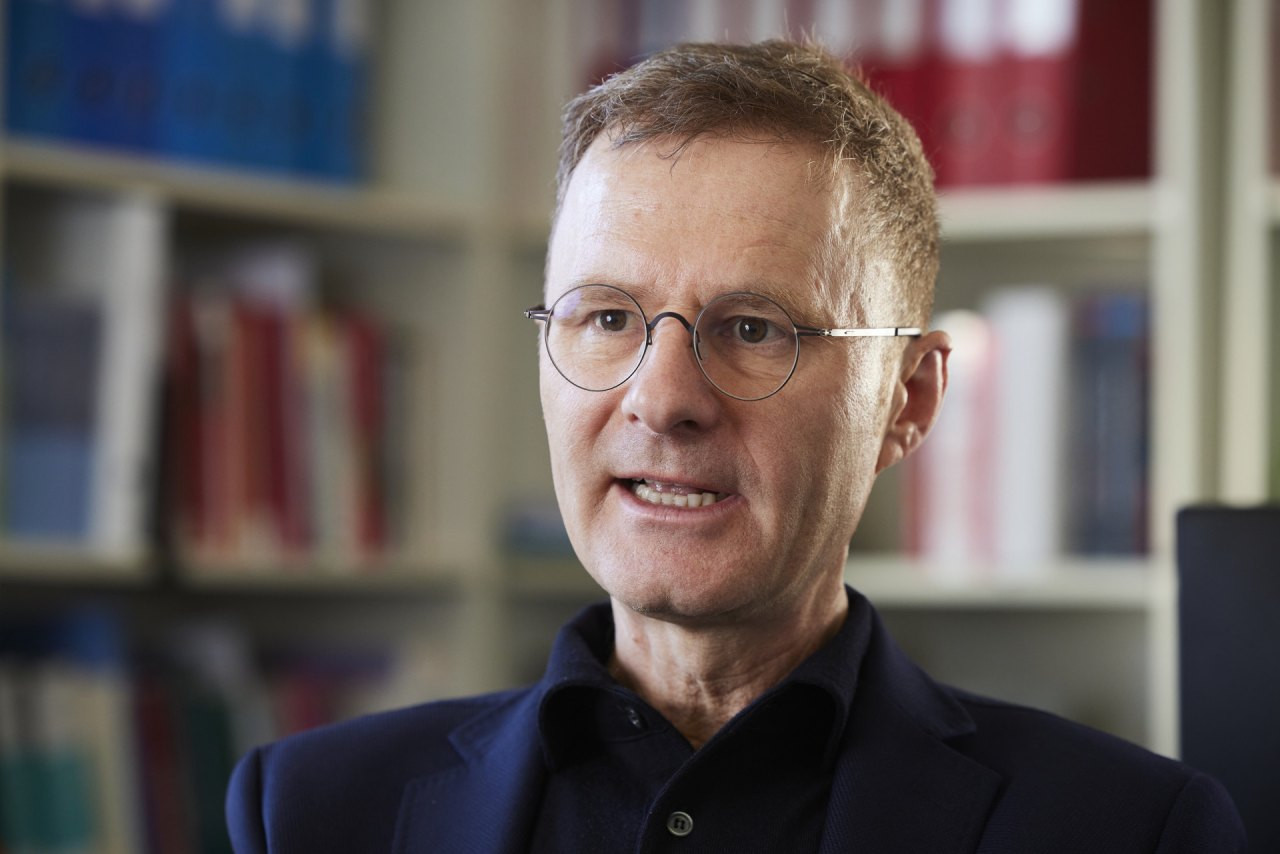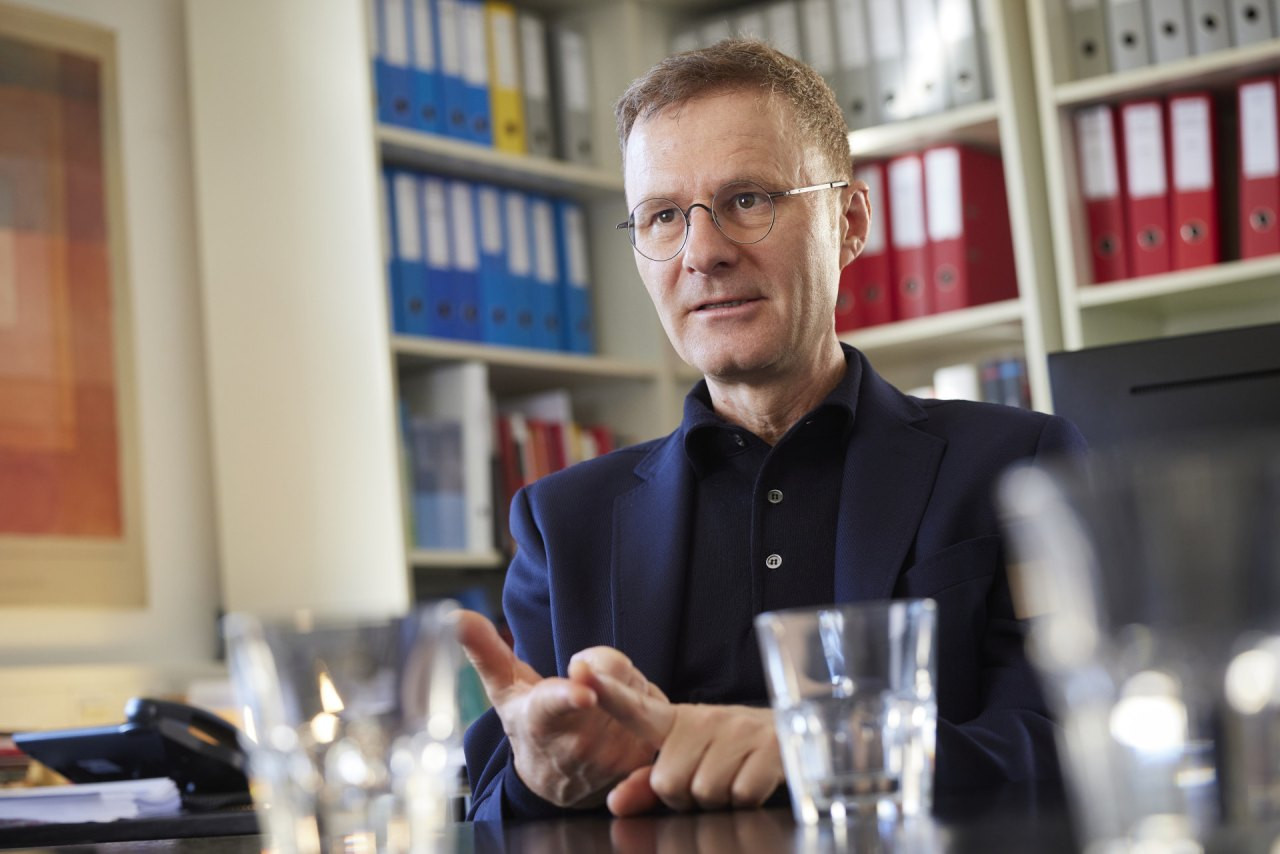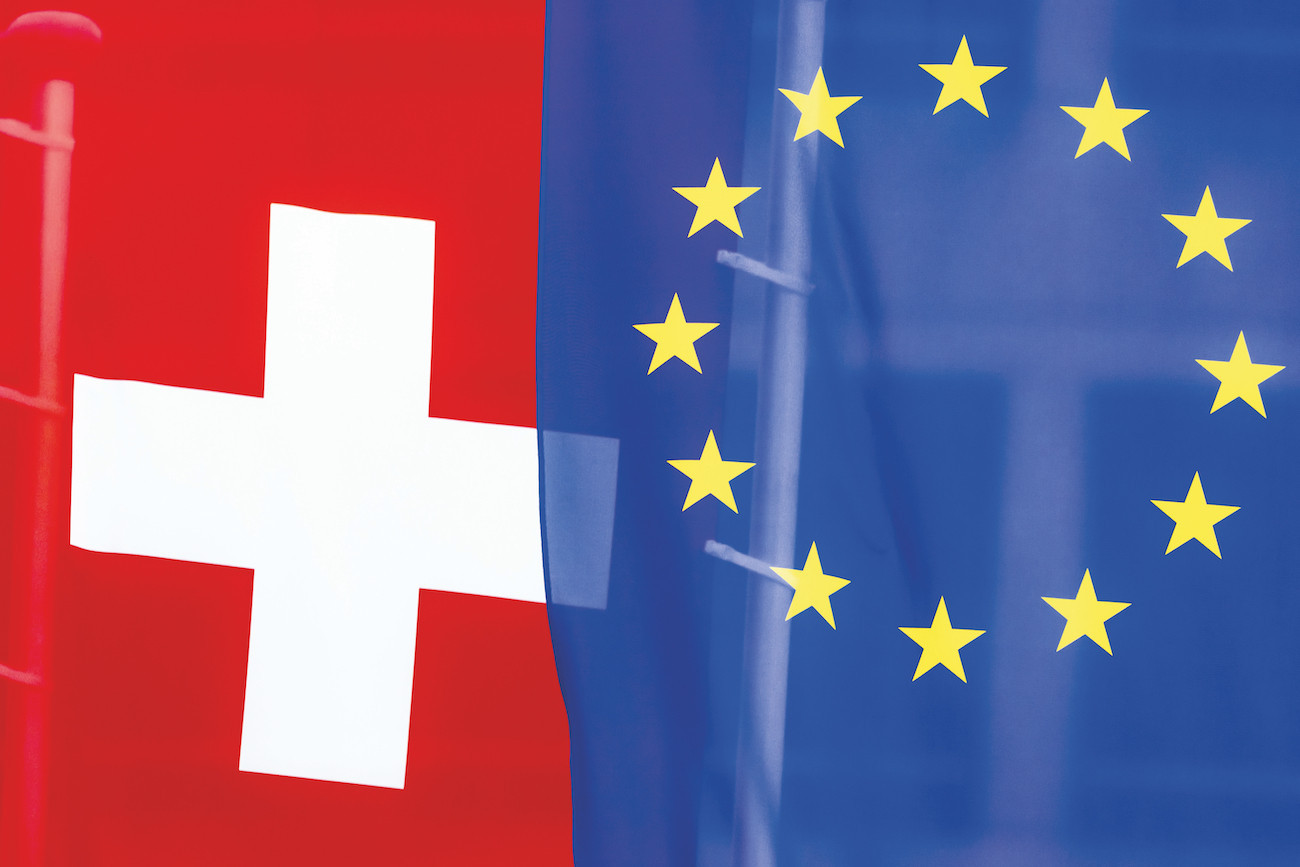Eine enorme Herausforderung ist auch der ökologischsoziale Umbau der Wirtschaft. Da mangelt es an Geld und mehr noch an den benötigten Fachkräften in den besonders geforderten Branchen.
Es gibt viele Leute, die produktiv arbeiten, aber wir haben auch einige in den Betrieben, die nicht so produktiv sind. Wir haben heute doppelt so viele Chefs wie vor 20 Jahren. Eine Klage, die wir im Gewerkschaftsalltag sehr oft hören, ist: «Der Chef nervt, aber wir wissen nicht, was er eigentlich arbeitet.» Wir haben eigentlich genügend Leute, und ich glaube, das Beste für die Schweizer Wirtschaft wäre, die Leute arbeiten zu lassen, statt dass die Chefs sie mit unnützen Ideen, die sie im Managementkurs gelernt haben, von der Arbeit abhalten. Das klingt vielleicht etwas provokativ, aber es liegt so viel ungenutztes Potential brach. Denn die Leute wissen in der Regel sehr gut, was sie tun müssen. Das ist nicht das Problem. Das Wichtigste ist, dass man die Leute arbeiten lässt, dann sind viele Dinge erledigt, die im Moment nicht erledigt werden können.