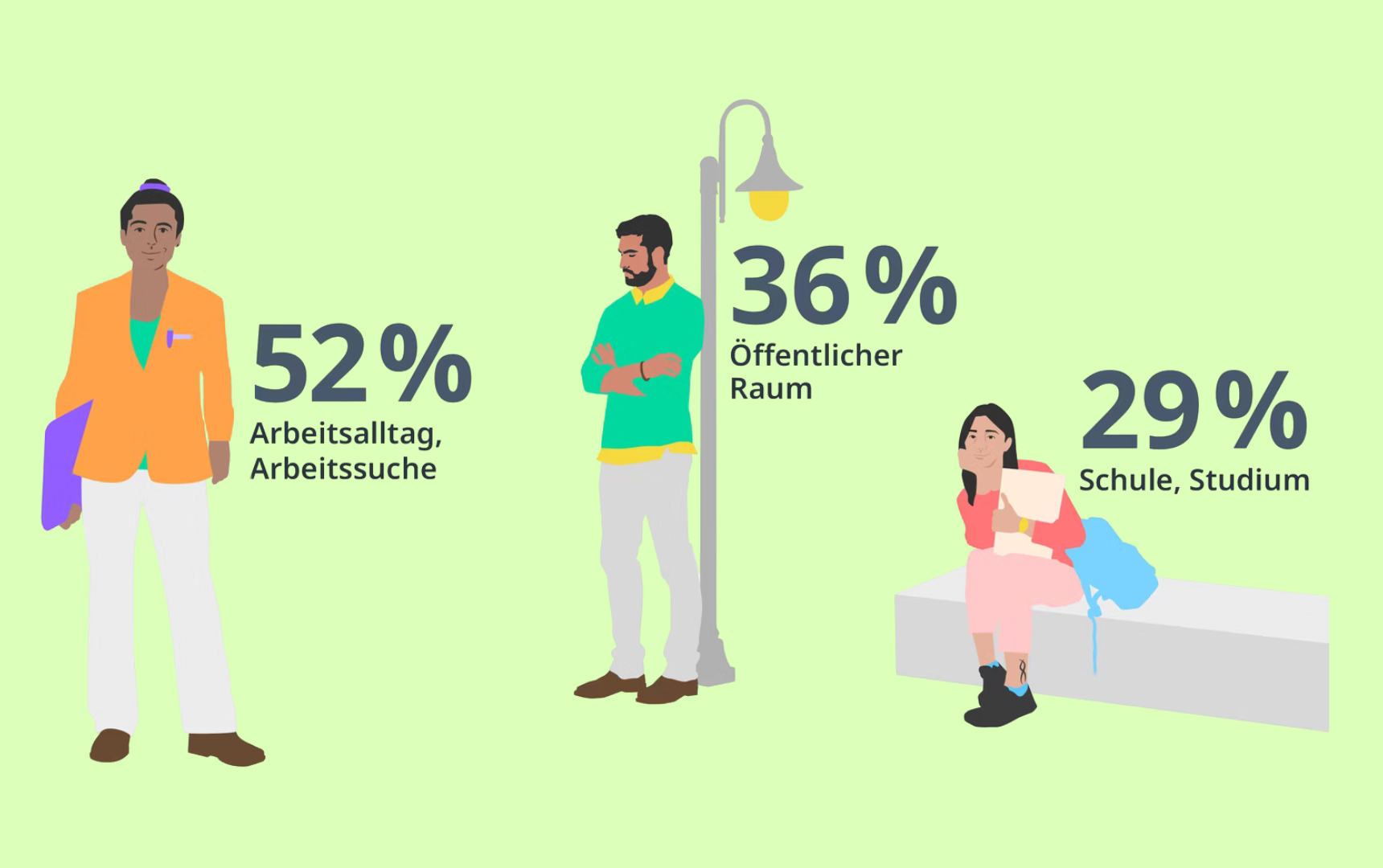work-VideoLaut und stark: Lakna über Musik, Haltung und das Unia-Konzert
Am 21. März organisiert die Gewerkschaft Unia im Gaskessel Bern das Konzert gegen Rassismus. Im Vorfeld haben wir mit Künstlerin Lakna über ihre Musik und den bevorstehenden Event gesprochen. https://youtube.com/shorts/L2YGa9jbPRA?feature=share Zeig Solidarität...