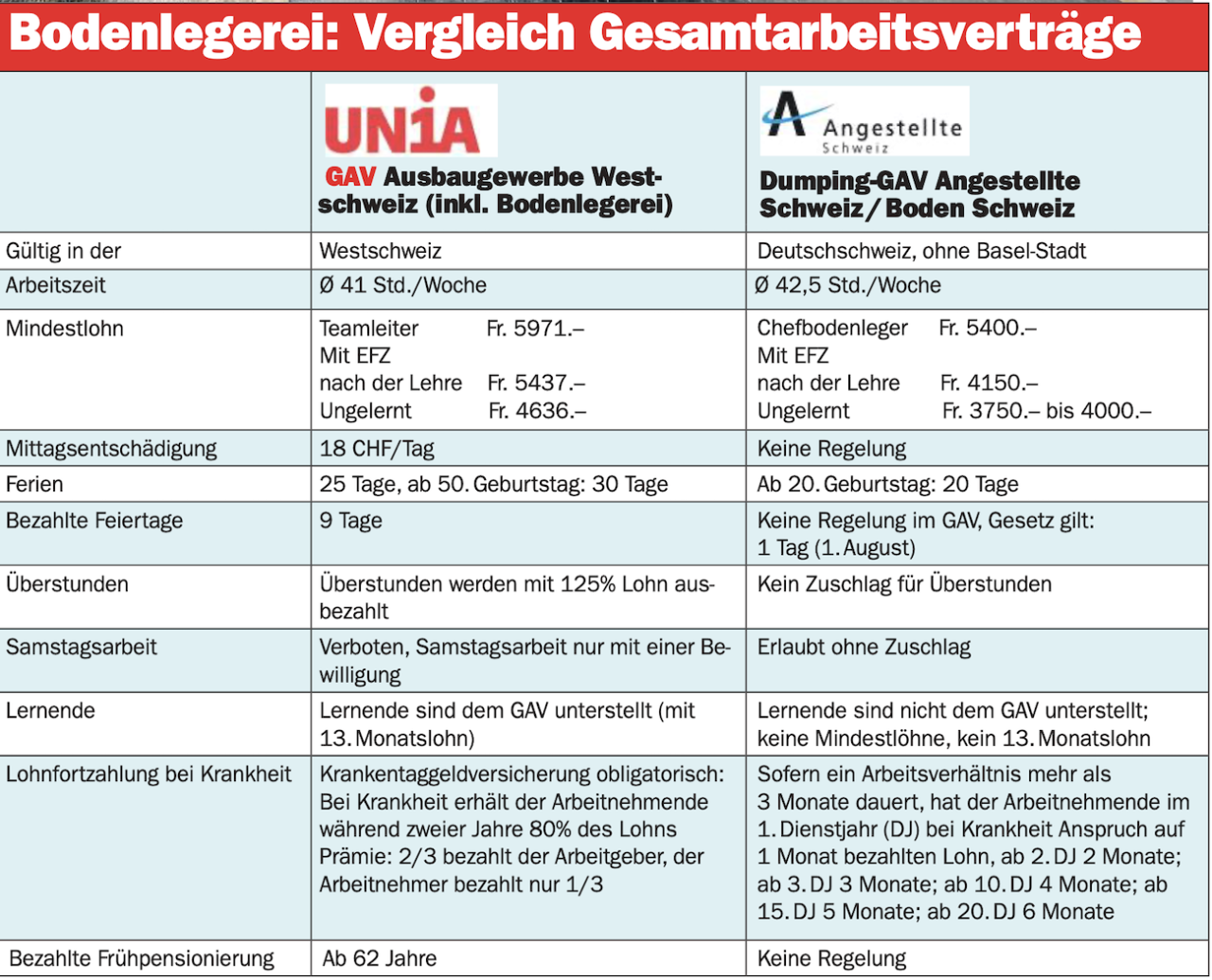Wegen Protesten vor Luxusboutiquen:Montblanc verklagt Gewerkschafter
Statt für anständige Arbeitsbedingungen in seinen italienischen Zulieferbetrieben zu sorgen, verklagt die Schweizer Edelmarke Gewerkschafterinnen. Doch diese lassen nicht locker.