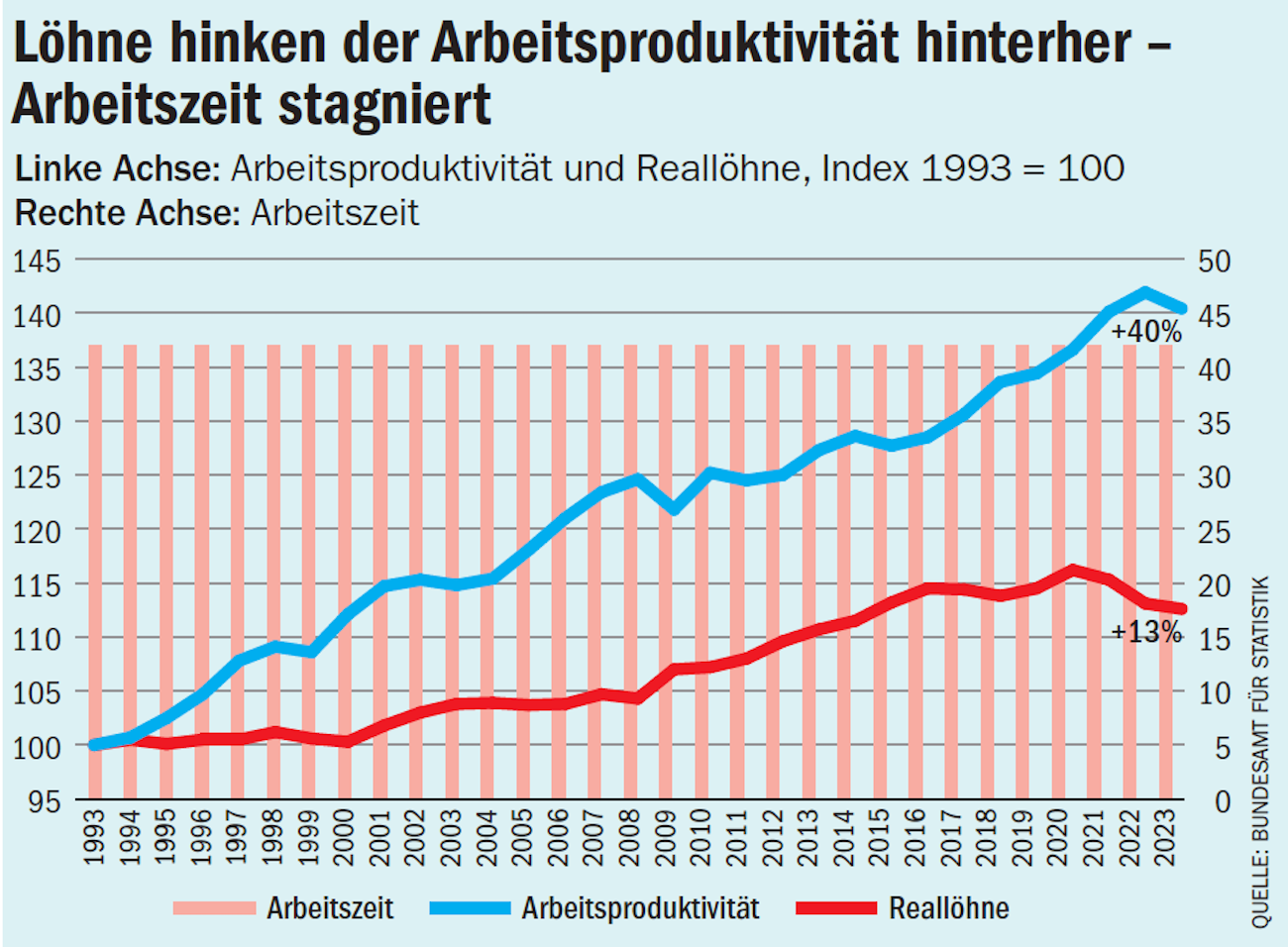Jean Ziegler ‒ la suisse existeGaza retten, um uns zu retten
Israelische Soldaten haben Mitte März in Rafah 15 palästinensische Sanitäter erschossen und sie neben ihren Ambulanzen im Sand verscharrt. Die Armee behauptete, sie seien nicht als Rettungskräfte erkennbar gewesen.