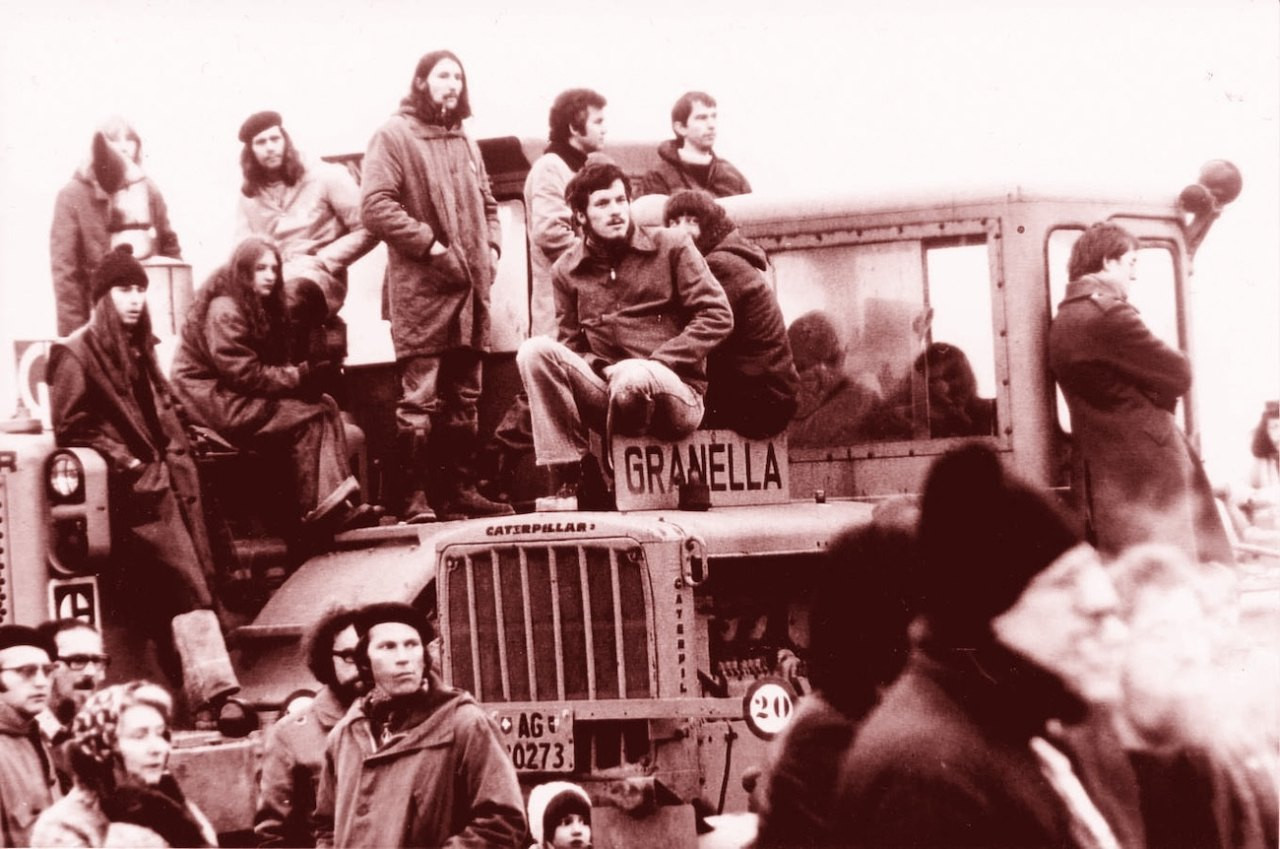RatgeberSocial-Media-Apps von Jugendlichen: Wir stellen die wichtigsten Plattformen vor
Sie benutzen Facebook? Dann müssen wir Ihnen leider mitteilen: Sie gehören zum alten Eisen. Teenager sind auf ganz anderen Kanälen unterwegs. Doch welche sind das, und wie werden sie genutzt?...