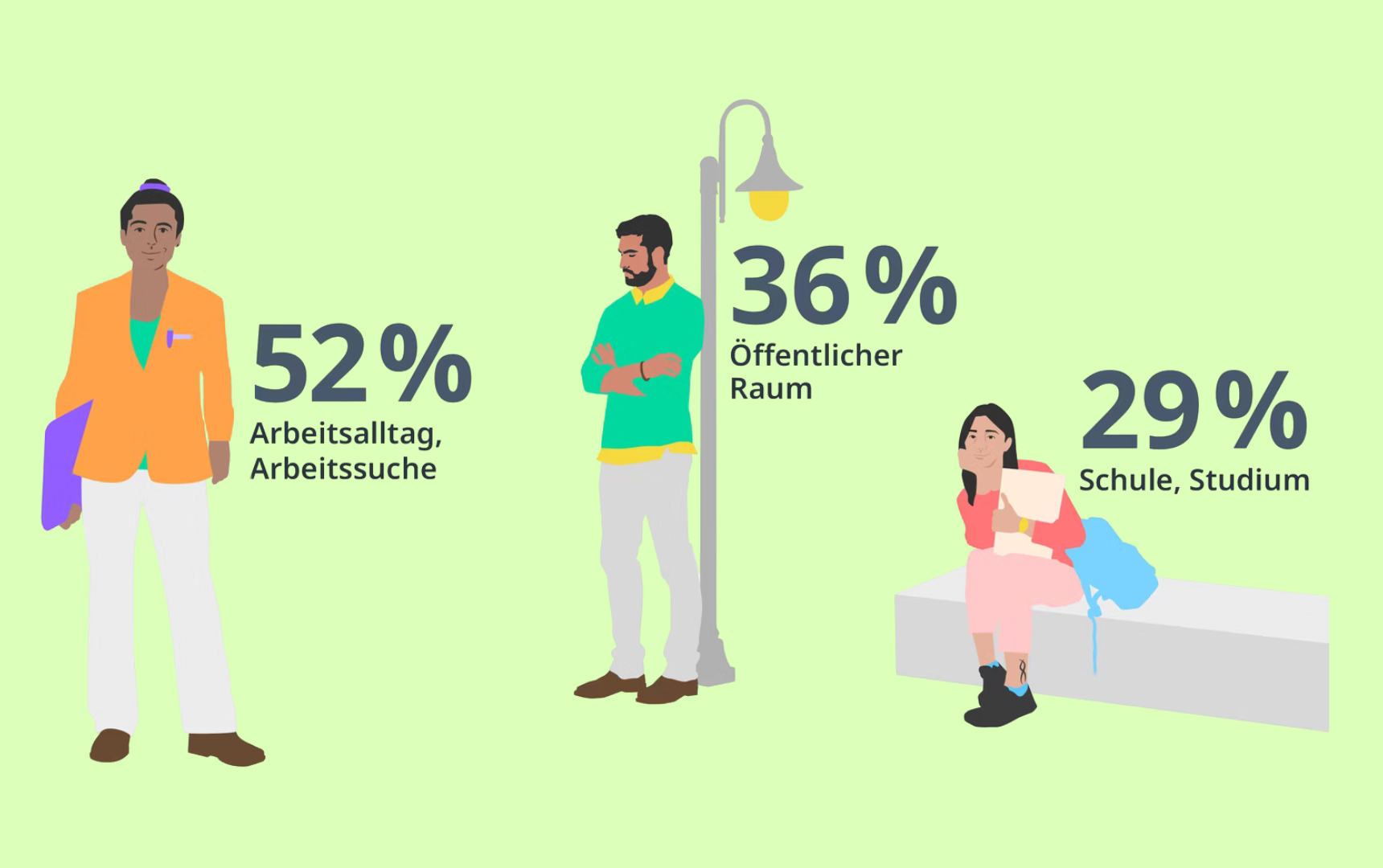Sehenswerter FilmEine Liebeserklärung, die wehtut: So hart ist die Arbeit in der Pflege
Eine Schicht in der Pflege, verdichtet auf Filmlänge. Klingt banal – doch der neue Spielfilm «Heldin» packt das Publikum sofort und lässt es nicht mehr los. Weil er der Realität...