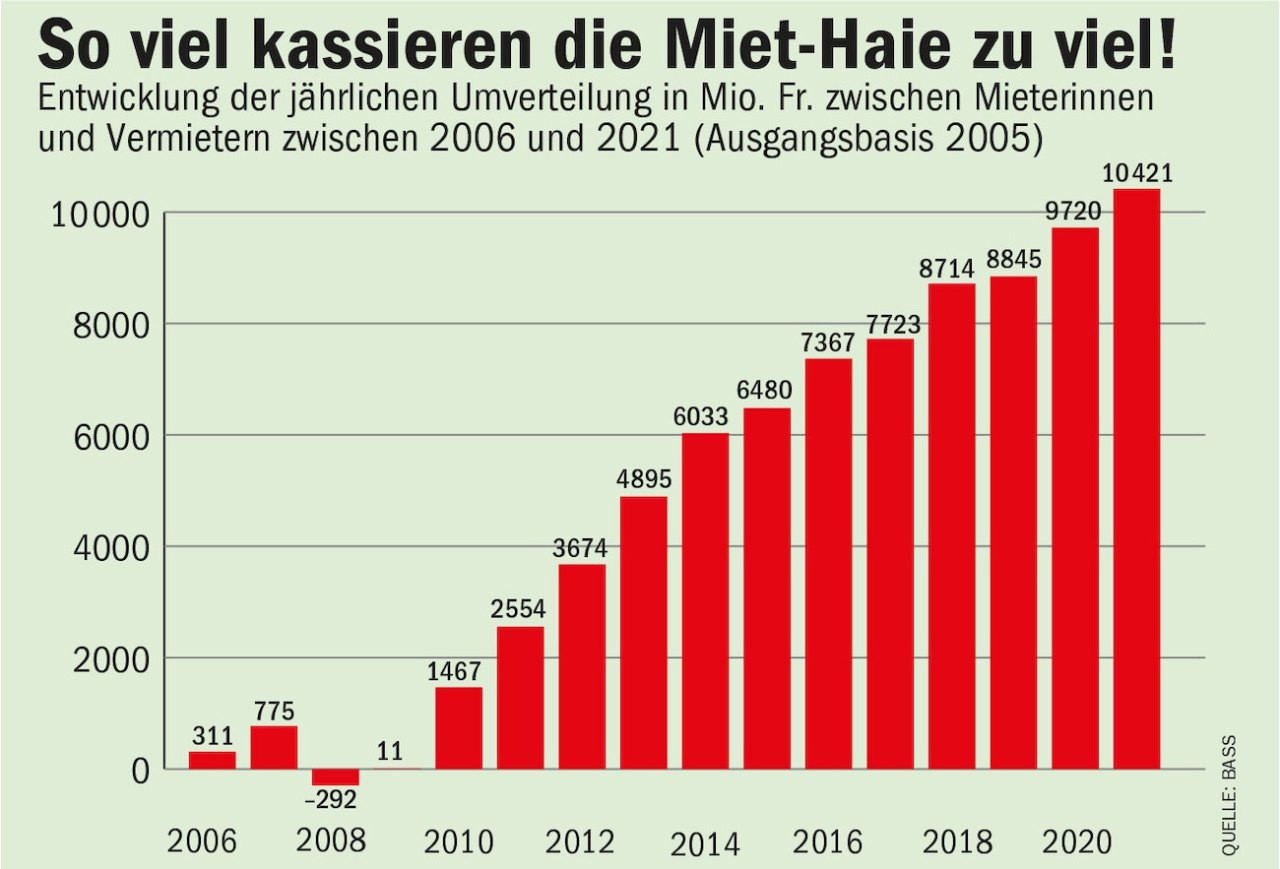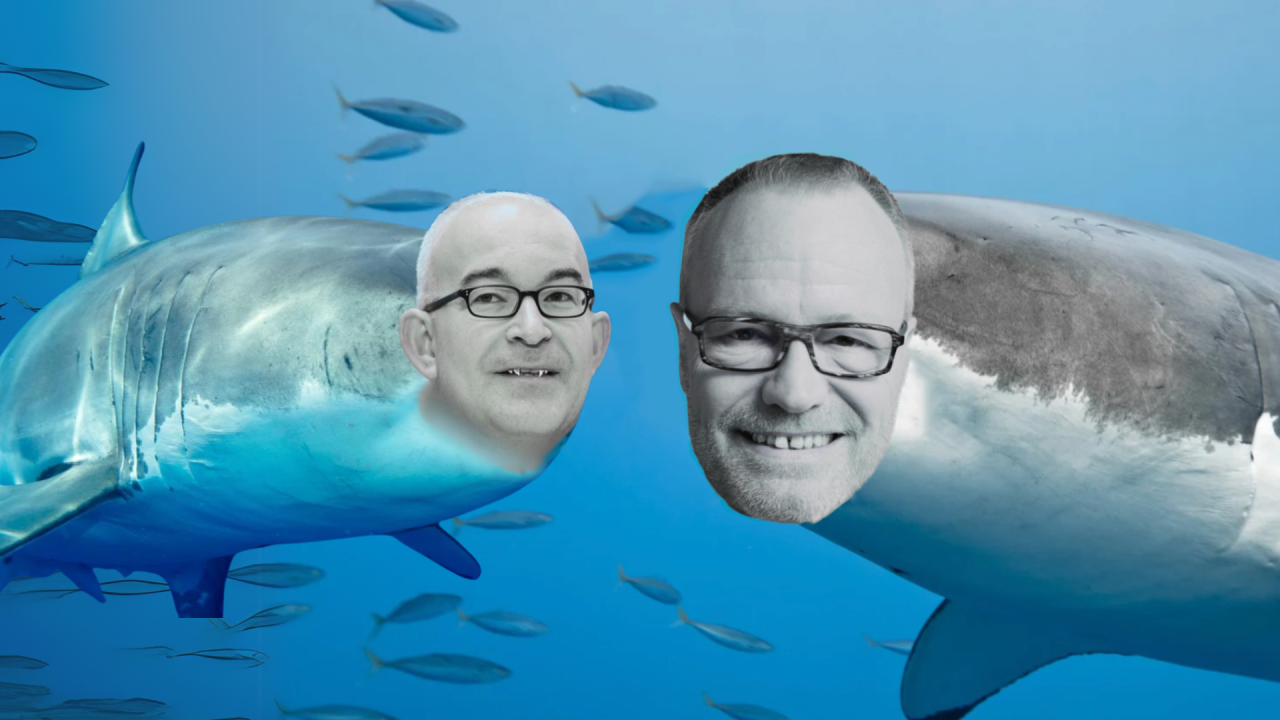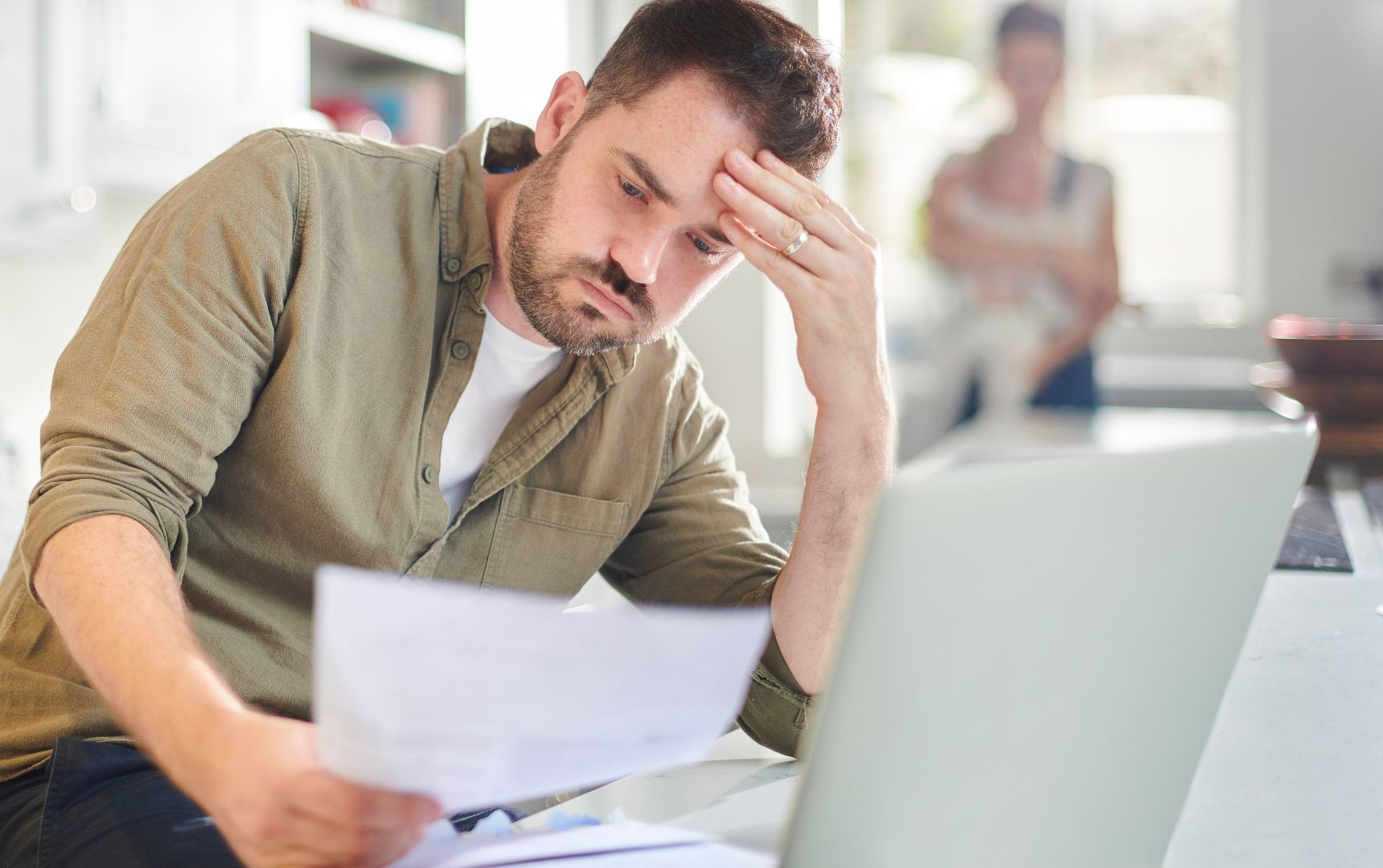Die Schweiz hat ein Armuts-Problem«Die Menschen müssen von ihrem Lohn leben und nicht nur knapp überleben können»
Aline Masé (38) ist Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik bei der Caritas Schweiz. Im Gespräch mit work erklärt sie, mit welchem Lohn man von Armut betroffen ist. Und warum Fleiss für...