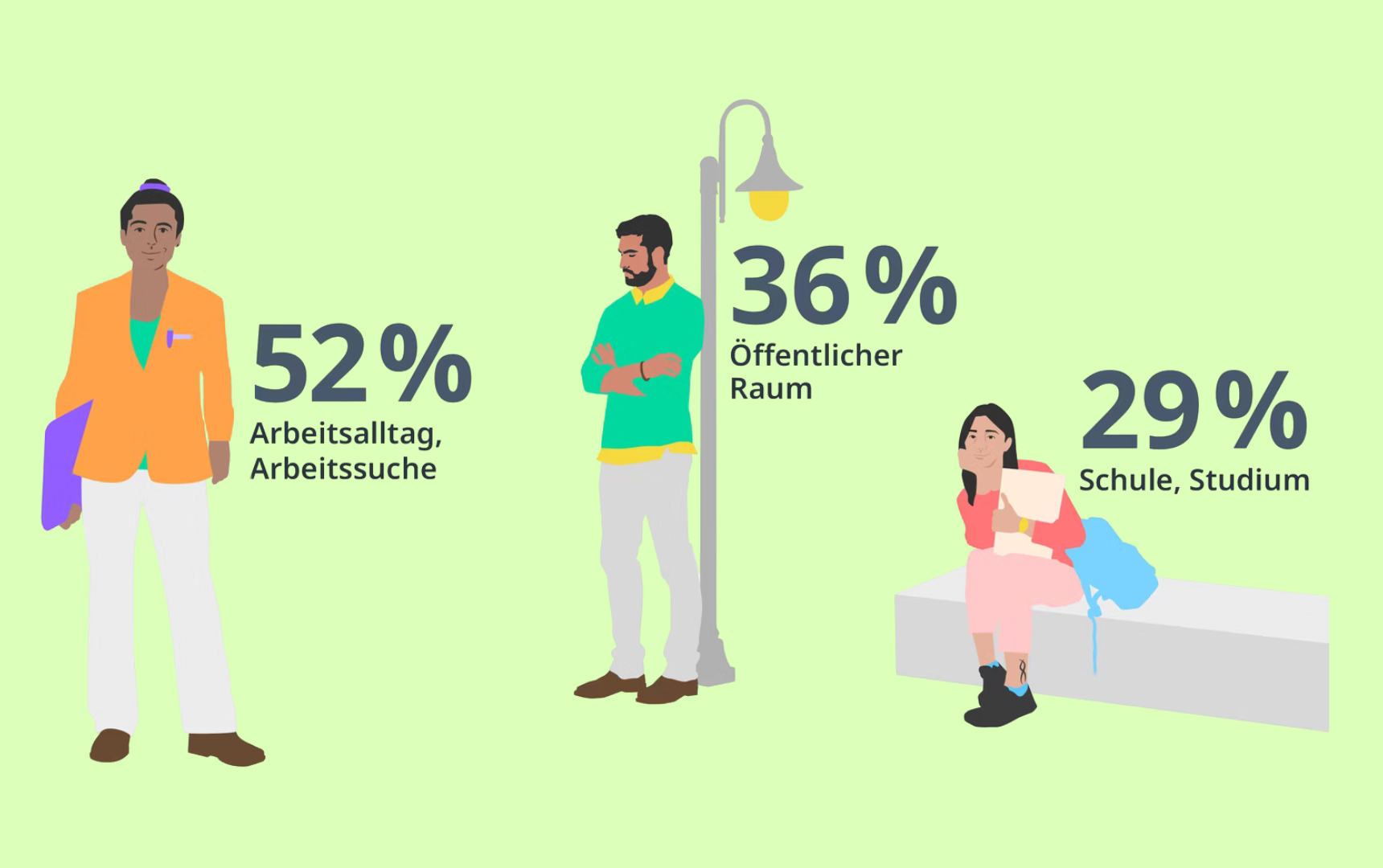Die Modebranche sorgt immer noch nicht für existenzsichernde Löhne in den Produktionsländern. Frühere Besserungsabsichten erwiesen sich als heisse Luft.

NUR SCHÖNER SCHEIN: Die grossen Modeketten foutieren sich um die Menschenrechte der Textilarbeiterinnen und -arbeiter. (Foto: Keystone)
Ob das Bio-Poloshirt von der Migros oder die Damenbluse von H & M – beides wird Hobbyshoppern und Schnäppchenjägerinnen derzeit wieder zu Spottpreisen nachgeworfen. Weniger als elf Franken kostet das Shirt, keine Zwanzigernote die Bluse. Möglich macht dies vor allem der Faktor Lohn: Tief ist er im Schweizer Detailhandel, oft nicht einmal existenzsichernd in den Produktionsländern des Südens. Ein Existenzlohn sichert ein würdiges Leben von mindestens zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Und: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verbrieft das Anrecht auf einen Existenzlohn. Dennoch wird ein erheblicher Teil der 75 Millionen Textilarbeiterinnen und -arbeiter der Welt zu Löhnen ausgebeutet, die kaum das nackte Überleben sichern. Daher stehen die Modekonzerne seit Jahren am Pranger von Gewerkschaften und Menschenrechtsgruppen. Besonders genau sieht die entwicklungspolitische Organisation Public Eye hin. Und stellt fest: In den letzten fünf Jahren haben die Modelabels wenig oder gar nichts getan, um die Löhne der Textilarbeiterinnen und -arbeiter zu erhöhen.
Nur einer einzigen Schweizer Modefirma war es gelungen,
erhebliche Zweifel an ihrer Geschäftspraxis auszuräumen.
IMAGEPOLITUR
Bereits 2014 nahm Public Eye die Lohnpolitik von Schweizer Kleidermarken unter die Lupe. Konkret überprüfte Public Eye, ob die Unternehmen dafür sorgten, dass ihre Zulieferer in den Produktionsländern Existenzlöhne bezahlten. Resultat: Von den fünfzehn untersuchten Schweizer Firmen wurden zehn als «ungenügend» und drei als «nachlässig» eingestuft. Nicht ein Unternehmen erhielt das Prädikat «gut». Die Billighäuser Metro Boutique, Tally Weijl und die 2017 pleitegegangene Kette Yendi fürchteten die Public-Eye-Enthüllungen gar so sehr, dass sie jegliche Kooperation verweigerten.
Nach Bekanntwerden der Resultate gelobten einige der Firmen Besserung. Sie beteuerten, ihre Lieferanten dazu bewegen zu wollen, anständige Löhne zu zahlen. Das schien dringend, denn der Ruf der globalisierten Textilindustrie war schwer beschädigt: Am 24. April 2013 war eine der unzähligen maroden Kleiderfabriken eingestürzt. Die Trümmer des Rana-Plaza-Werks in Bangladesh begruben über 3500 Textilarbeiterinnen, 1138 von ihnen starben. Public Eye hatte also allen Grund, die Modemarken beim Wort zu nehmen. Das tat die Organisation und legte nun, nach fünf Jahren, erneut einen detaillierten Faktencheck vor. Mit ernüchterndem Fazit.
NICHTS ALS PHRASEN
Von den 45 befragten Modefirmen – 19 davon aus der Schweiz – konnten nur gerade zwei erhebliche Zweifel an ihrer Geschäftspraxis ausräumen. Es handelt sich um die Schweizer Firma Nile und die italienische Marke Gucci. Public-Eye-Sprecherin Géraldine Viret sagt: «Von ihnen erhielten wir Informationen, die darauf schliessen lassen, dass zumindest ein Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer Lieferkette einen Existenzlohn erhält.» Ganz im Gegensatz zu Schweizer Firmen wie Chicorée, Coop, Manor, PKZ oder Tally Weijl. Sie verwiesen lediglich auf den vom Branchenverband Amfori erarbeiteten Verhaltenscodex.
Dieser betrachtet den Existenzlohn – Menschenrechte hin oder her – lediglich als «erstrebenswertes Ziel» und nicht als verbindliche Verpflichtung. «Eine angemessene Vergütung» lautet das Quantum, das der Codex vorsieht. Interpretationsspielraum ist also reichlich vorhanden. Und der wird rege genutzt. Von H & M etwa. Der schwedische Konzern lässt seine Kleider immer öfter in Äthiopien herstellen. In den dortigen Textilfabriken beträgt der durchschnittliche Monatslohn umgerechnet 26 US-Dollar. Ein Wert weit unterhalb der von der Weltbank definierten Armutsgrenze von 58 Dollar. Ein Geschäftsmodell, das sich für H & M lohnt: Im letzten Jahr erzielte der Modegigant einen satten Gewinn von rund 1,5 Milliarden Franken.
Die Public-Eye-Studie samt Firmencheck gibt es hier: rebrand.ly/Firmencheck.