Corona-Bekämpfung:Geld oder Leben? Daneben!
Gibt es einen Widerspruch zwischen Pandemiebekämpfung und Wirtschaftsleben? Nein, sagen die Daten.
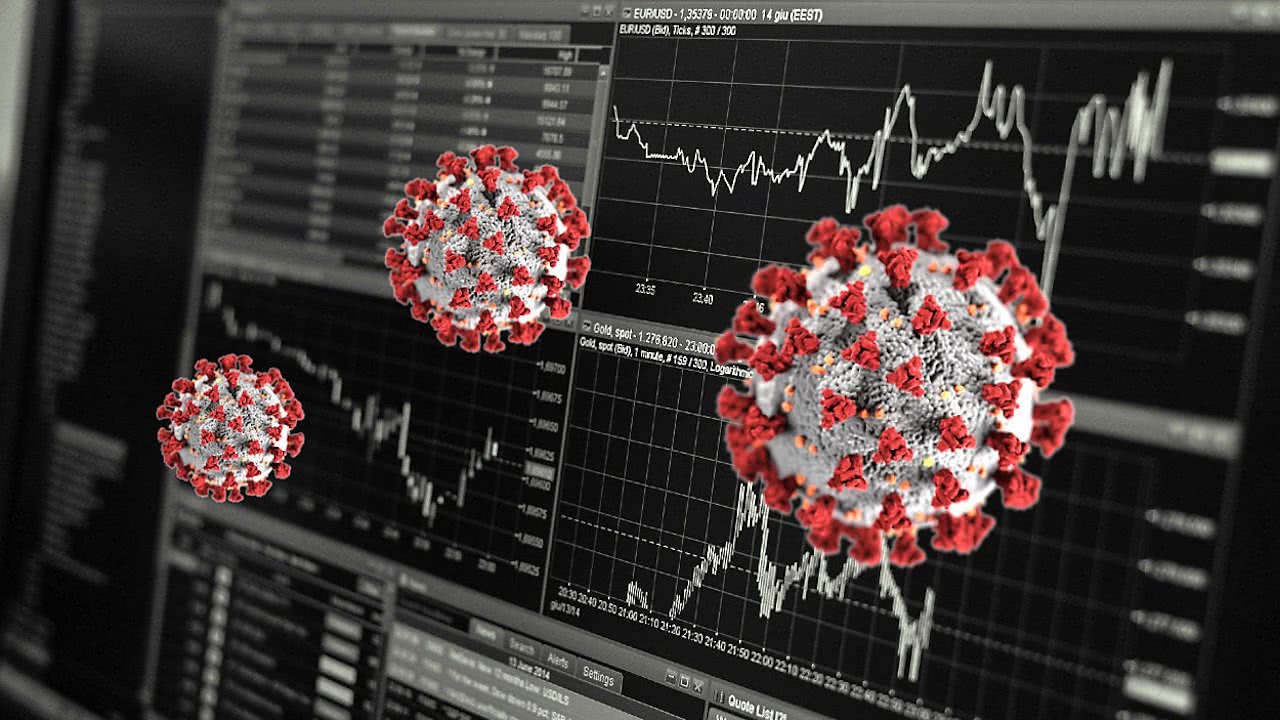
Fast 9000 Franken Miete im Monat und null Einnahmen: Das geht nicht mehr lange gut, sagt Suthakaran Baskarasivaji vom Berner Restaurant Musigbistrot.

Beizer Suthakaran Baskarasivaji: «Die Beizenschliessung war richtig. Auch Gastrosuisse muss akzeptieren, dass gegen diese Pandemie alle mithelfen müssen.» (Foto: Yoshiko Kusano)
Die Tür ist abgeschlossen, die Stühle hochgestellt. Das «Musigbistrot» im Berner Monbijou-Quartier ist seit fast einem Monat zu. So wie alle Beizen im Land: Trotzdem lacht Suthakaran Baskarasivaji, als er work empfängt. Er sei ein positiver Mensch, sagt der Präsident der Genossenschaft, die das Lokal führt. «Ich bin 200 Prozent motiviert, das ‹Musigbistrot› am Leben zu erhalten. Konkurs ist keine Option.»
Doch die Zahlen, die der 49jährige auswendig kennt, verheissen nichts Gutes: Juni bis August seien noch okay gewesen, «aber im September machten wir 10 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr. Im Oktober 50 Prozent weniger, im November 70 Prozent weniger.» Vor allem, weil der Kanton Bern Anlässe mit mehr als 15 Personen verbot. Firmenapéros, Geburtstage und Weihnachtsessen fielen ins Wasser. Und seit der Bundesrat am 22. Dezember die Beizen schloss, betragen die Einnahmen null Franken.
Die fixen Ausgaben aber bleiben. Vor allem die Miete, 8800 Franken im Monat. Während des ersten Lockdowns habe die Eigentümerin den Mietzins reduziert. Aber von Juni bis Dezember habe er die volle Miete bezahlt, sagt Baskarasivaji : «Das ist wichtig. Wenn wir die Kündigung bekommen, ist das das Ende.»
Neben anderen Fixkosten wie Strom und Sozialabgaben schmerzen den Beizer vor allem die Lebensmittel, die er wegwerfen musste. Zum Beispiel Bier für den Offenausschank. Eine Lieferung umfasse jeweils 20 Fässer, sagt er: «Das Bier hat ein Ablaufdatum. Danach dürfen wir es nicht mehr ausschenken.» Insgesamt habe er im ersten Lockdown Waren im Wert von fast 10’000 Franken entsorgen oder verschenken müssen.
Es klopft an der Tür. Der Pöstler bringt einen Stapel Briefe. Baskarasivaji schaut sie kurz durch: «Noch mehr Rechnungen.» Im Herbst nahm er ein Darlehen auf, um für die laufenden Kosten des «Musigbistrots» aufzukommen. Nicht im Namen der Firma, sondern privat. Mit 50’000 Franken steht er seither bei einem Freund in der Kreide. Er sagt: «Wir Tamilen helfen einander.»
Aber jetzt, mit dem zweiten Beizen-Lockdown bis mindestens Ende Februar, reicht auch das nicht mehr. Der Betrieb braucht Unterstützung, um überleben zu können. Immerhin: Jetzt gelten Restaurants automatisch als Härtefälle. Auch Baskarasivaji will deshalb beim Kanton Hilfe beantragen. Und vor wenigen Tagen hat er der Vermieterin einen Brief geschrieben und angefragt, ob er einen Teil der Miete erst später bezahlen könne. Eine Antwort hat er noch nicht.
Das «Musigbistrot» ist auch Mitglied beim Arbeitgeberverband Gastrosuisse. Mit dessen Lobbying für eine rasche Wiederöffnung der Beizen im Frühling und gegen strengere Corona-Massnahmen in der zweiten Welle ist Baskarasivaji aber gar nicht einverstanden: Zwar sei es für den Betrieb und für ihn persönlich «schlimm» gewesen, als der Bundesrat die Beizen wieder geschlossen habe: «Aber für das ganze Land war es richtig. Auch Gastrosuisse muss akzeptieren, dass gegen diese Pandemie alle mithelfen müssen.»
Alle gemeinsam: Das gilt auch im «Musigbistrot». Und zwar seit 2015. Damals ging der Wirt konkurs. Den Mitarbeitenden drohte die Arbeitslosigkeit. Da enstand im Team die Idee, das Lokal selber weiterzuführen – als Genossenschaft. Baskarasivaji war einverstanden: «Ich hatte als einziger schon Erfahrung mit Firmengründungen, früher hatte ich ein Geschäft für tamilische Lebensmittel, später auch ein Restaurant. Ich sagte den anderen: Kommt, wir machen das! Das ist besser, als stempeln zu gehen.»
Sieben von zehn Mitarbeitenden waren interessiert. Sie holten sich Rat bei der Unia, schrieben einen Businessplan. Jeder und jede trieb irgendwo 5000 Franken auf. Und dann sprachen sie bei der Vermieterin vor. Ebenfalls eine Genossenschaft: die gemeinnützige Fambau, ihr gehören in Bern und Umgebung 2600 Wohnungen. Und, was Baskarasivaji noch heute freut: «Sie gab uns diese Chance.»
Danach sei das Bistrot fast wie bisher weiter gelaufen, nur mit noch mehr Motivation und Einsatz, «weil es jetzt uns gehörte». Von den sieben Gründerinnen und Gründern sind vier auch heute noch dabei, drei neue sind dazugekommen. Baskarasivaji sagt: «Wir sind wie eine Familie geworden. Es ist das beste Team, das man sich vorstellen kann!»
2019 wurde er Präsident. Aber sein Lohn bleibt gleich: «4500 Franken im Monat, gleich viel wie der Koch.» Wichtige Fragen bespreche man gemeinsam, sagt er. «Aber wir haben auch abgemacht: Wenn fertig diskutiert ist, entscheide ich, wie wir es machen.» Auch für die Finanzen müsse am Schluss er alleine geradestehen. «Besser, nur einer geht konkurs als alle sieben», sagt er und lacht wieder. Und lässt keine Zweifel offen: So weit will er es nicht kommen lassen.