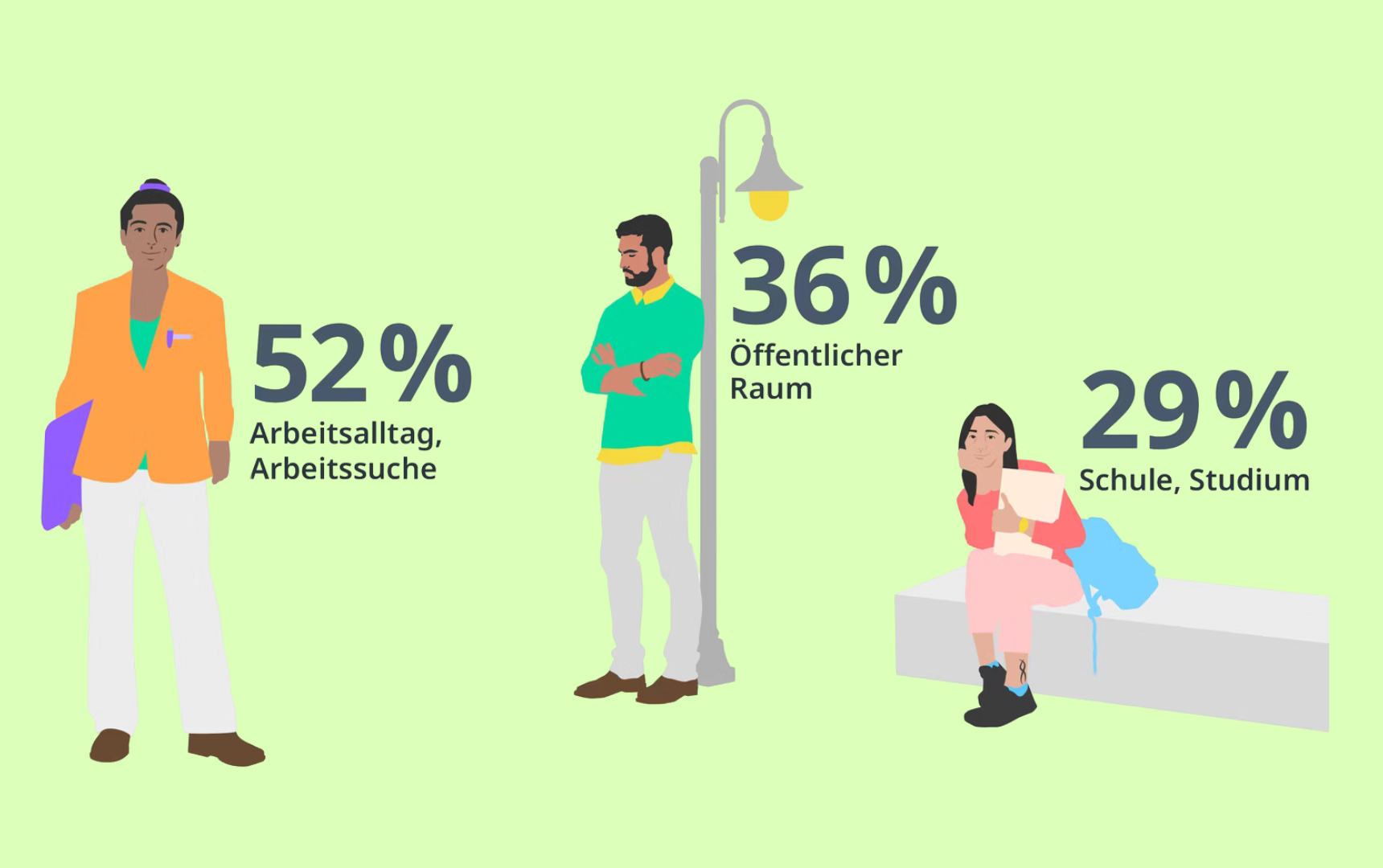Die amerikanische Vereinigung für Krebsforschung (AACR) hat dem Onkologen Franco Cavalli ihren prestigeträchtigen Preis für sein Lebenswerk verliehen und damit zum ersten Mal einem Schweizer. Für Cavalli ist klar: je tiefer das Einkommen, desto tödlicher der Krebs.

KREBSFORSCHER FRANCO CAVALLI: «Die Pharmaunternehmen sollten gezwungen werden, Medikamente zu produzieren, die für ärmere Länder zugänglich sind.» (Foto: Keystone)
Claudio Carrer: Wie haben sich die Krebserkrankungen im Laufe der Jahrzehnte verändert?
Franco Cavalli: Eine allgemeine Einschätzung ist nicht möglich, weil Krebs so viele verschiedene Krankheiten umfasst. Als ich 1972 anfing, wussten wir allerdings viel weniger darüber als heute. Bei bestimmten Krebsarten waren die Prognosen schlecht: Bei Hodenkrebs, der vor allem junge Menschen betrifft, starben alle, während heute praktisch alle geheilt werden. Bei Brustkrebs wurde eine von fünf Frauen geheilt, während es heute fast vier von fünf sind. Dann gibt es noch andere Krebsarten, bei denen sich relativ wenig geändert hat.
In diesen Jahren gab die Chemotherapie viel Grund zur Hoffnung.
In jenen Jahren herrschte Begeisterung, weil es dank der Chemotherapie die ersten Heilungen gab. Diese ist übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg eher zufällig als Produkt der amerikanischen Kriegsforschung entstanden. Mit der Illusion, dass eines Tages alle geheilt sein würden, haben die Medizinerinnen und Mediziner jedoch immer anstrengendere Behandlungen durchgeführt. Bis man erkannte, dass es eine Grenze gibt. Die Chemotherapie als Methode zur Abtötung sich schnell teilender Zellen konnte nichts ausrichten gegen die vielen Tumoren, in denen sich die Zellen langsam teilen. Es war vor allem das Pflegepersonal, das darauf hinwies, dass zu viele Patientinnen und Patienten unter den schweren Folgen der Therapie litten, ohne einen Nutzen daraus zu ziehen. So begann eine Phase, in der mehr auf die Lebensqualität geachtet wurde. Und parallel dazu wurden neue Therapien entwickelt, die «intelligenter» waren als die Chemotherapie, die wahllos alle Zellen tötet. Zum Beispiel die Immuntherapie, eine Methode zur Stärkung unserer Abwehrkräfte gegen Krebs. Diese war vierzig Jahre lang eine Enttäuschung, aber seit Beginn dieses Jahrhunderts ein grosser Erfolg und heute eine der grössten Hoffnungen.
Warum bekommen wir Krebs?
Es wird geschätzt, dass wir etwa 40 Prozent aller Krebserkrankungen vermeiden könnten, wenn wir alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Umwelt oder einem ungesunden Lebensstil vermeiden würden. Etwa 5 bis 6 Prozent der Fälle sind dagegen auf genetische Veranlagung zurückzuführen. In der Hälfte aller Fälle entsteht Krebs zufällig.
Krebs wird voraussichtlich die häufigste Todesursache in der Welt werden und damit die Herz-Kreislauf-Erkrankungen überholen. Wie lässt sich dies trotz den Fortschritten in der Behandlung erklären?
In den reichen Ländern nimmt die Zahl der Krebsfälle im Verhältnis zur höheren Lebenserwartung nur relativ wenig zu. Der grosse Anstieg ist vor allem in den armen Ländern zu verzeichnen, in denen es weder Prävention noch Früherkennung gibt und wo die Umweltbedingungen schlechter sind und chronische Infektionen grassieren. Die Tatsache, dass Krebs in 20 bis 30 Jahren die weltweit häufigste Todesursache sein wird (in vielen Regionen ist sie es bereits), ist auch auf die Fortschritte zurückzuführen, die bei der Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erzielt wurden, die viel bedeutender sind als die von Krebs.
Wir wissen, dass bestimmte Stoffe wie Asbest oder Holzstaub Krebs verursachen können. Gibt es weitere Zusammenhänge zwischen Arbeit und Arbeitsbedingungen und dieser Krankheit?
Toxische Faktoren wie Staub, Farbstoffe, Benzin und andere sind zum Teil bekannt, zum Teil aber auch nicht, vor allem wenn die Auswirkungen nicht so stark und daher schwer zu messen sind. Und dann ist da noch der allgemeine Lebensstil. Es ist klar, dass soziale Faktoren eine sehr wichtige Rolle sowohl für das Auftreten von Krebs als auch für das Ergebnis der Behandlung spielen. Man schätzt, dass in Europa jeder dritte Krebstod bei Männern und jeder sechste bei Frauen darauf zurückzuführen ist, dass die Patientinnen oder Patienten einer unterprivilegierten sozialen Schicht angehören.
Wieso ist das so?
Dafür gibt es verschiedene Gründe: Sie sind weniger gut informiert und rauchen daher mehr, sie arbeiten in anstrengenderen Berufen, sie führen einen weniger gesunden Lebensstil (schlechte Ernährung, wenig Sport). Und oft gerade wegen der Art ihrer Arbeit. In Nordengland und Schottland beispielsweise gibt es Arbeiterviertel, in denen der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen Arm und Reich ähnlich gross ist wie der zwischen uns und Entwicklungsländern, nämlich etwa 15 bis 20 Jahre.
Wird das Präventionspotential also nicht ausgeschöpft?
Nein. Weniger als ein Prozent der Investitionen im Krebs-Sektor fliesst in die Prävention und kaum mehr in die Früherkennung. Der Grossteil wird für die Behandlung ausgegeben, weil die Pharmaindustrie stark davon profitiert. Und die Staaten tun relativ wenig: Um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen, ist die Prävention wenig «interessant», weil die Ergebnisse nicht während einer Legislaturperiode sichtbar sind, sondern erst nach Jahrzehnten.
Wie würden Sie Ihren Beitrag zur Krebsforschung zusammenfassen?
Während meiner ersten Ausbildungsjahre in Bern habe ich mich mit Leukämie, Brustkrebs und neuen Medikamenten beschäftigt. Zurück im Tessin, wo es keine Krebsforschung gab, habe ich mich dann zunächst mit der Erforschung neuer Medikamente beschäftigt. Später aber konzentrierte sich meine Forschung hauptsächlich auf die bösartigen Erkrankungen des lymphatischen Systems, ein Thema, dem ich seit 1981 die Internationale Konferenz in Lugano widme, die weltweit wichtigste Veranstaltung auf diesem Gebiet.
Wie sehen Sie die Zukunft der Forschung, und was sind die Prioritäten?
Zunächst einmal gibt es einen geopolitischen Aspekt: Bösartige Tumore werden zunehmend zu Krankheiten des ärmsten Teils der Gesellschaft. Laut Schätzungen wird die Krebssterblichkeit in den armen Ländern zwischen 2020 und 2040 um 100 Prozent zunehmen, was sowohl auf Umweltfaktoren als auch auf mangelnde Prävention, Früherkennung und Behandlung zurückzuführen ist. Ein Beispiel: Die Hälfte der Länder Afrikas verfügen nicht einmal über ein Strahlentherapiegerät, während wir in der Schweiz 35 Zentren haben. Es besteht also ein Bedarf an Sensibilisierung auf globaler politischer Ebene. Leider haben sich die verschiedenen G-20- und G-7-Staaten bisher geweigert, sich damit zu befassen. Unsere Aufgabe als Forscher und Ärzte ist es, die Politik dazu zu zwingen. Und was die Behandlung anlangt, so sollten zunächst die Pharmaunternehmen gezwungen werden, Medikamente zu produzieren, die für ärmere Länder zugänglich sind, wo sie sich heute nur ein Prozent der Bevölkerung leisten kann. Generell glaube ich auch, dass wir viel mehr in Prävention und Früherkennung investieren müssen. Hier stehen wir vor einer grossen Veränderung: In einigen Jahren werden wir eine Reihe von Bluttests haben (an denen wir auch hier im Tessin arbeiten), die es ermöglichen werden, das mögliche Vorhandensein eines Tumors irgendwo zu erkennen. Wir sollten mehr in diese Richtung investieren als in neue Medikamente, die ein wenig besser wirken als die bisherigen, aber zehnmal so viel kosten.
* Dieser Artikel ist zuerst in der italienischsprachigen Unia-Zeitung «Area» erschienen. work publiziert ihn in einer gekürzten Fassung.
Weltspitze: Cavalli ist international angesehen
Franco Cavalli (81) ist Arzt und Onkologieprofessor. Bis 2017 war der Tessiner wissenschaftlicher Direktor des onkologischen Instituts der italienischen Schweiz (IOSI). Mit seinen zahlreichen internationalen Auszeichnungen gehört er zur Weltspitze seines Fachs. Als Gesundheitspolitiker wirkte der überzeugte Marxist zwölf Jahre für die SP im Nationalrat. Cavalli ist Präsident des Hilfswerksverbunds Medicuba Europa.