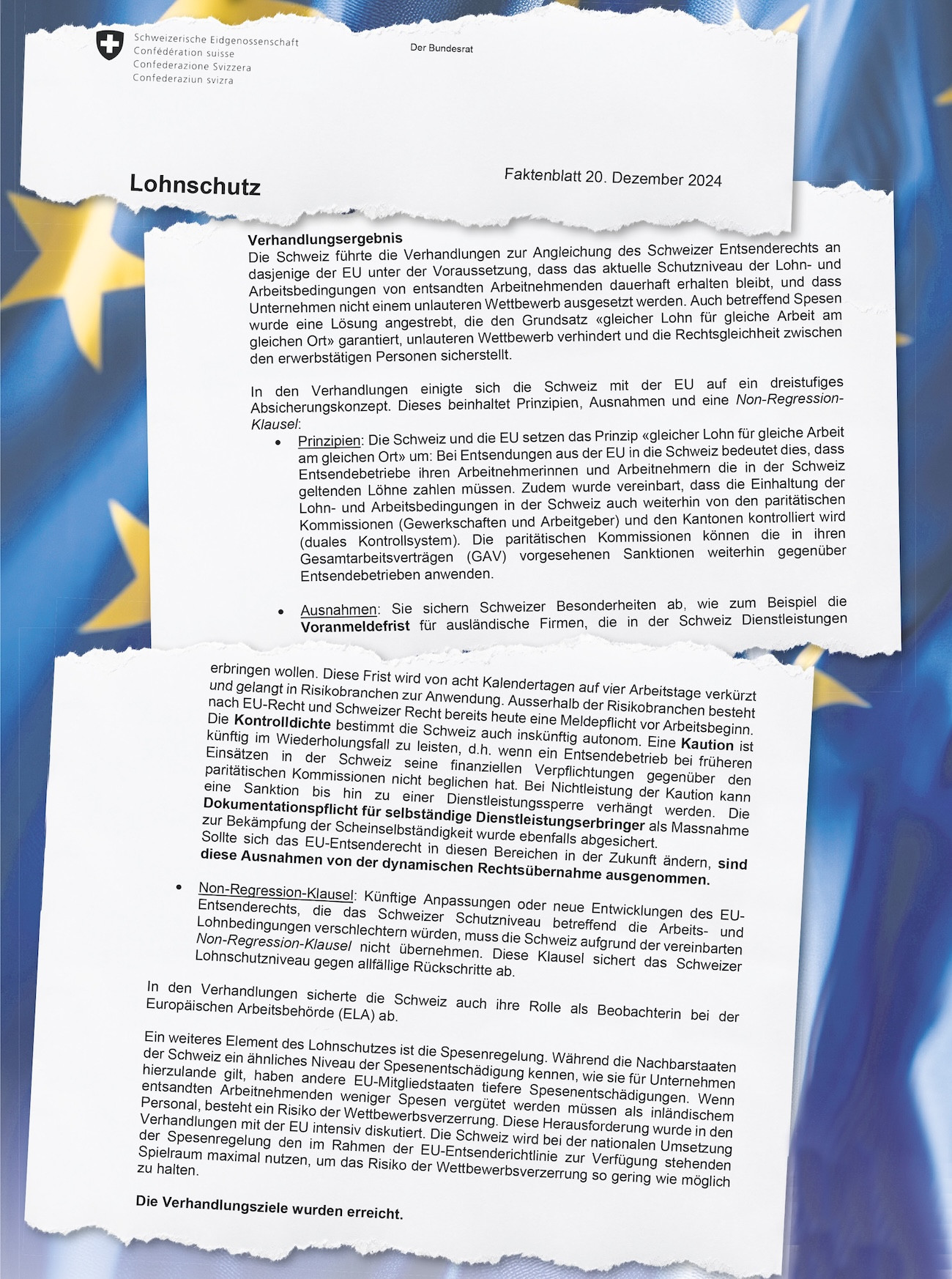Unia-Delegierte stellen Forderungen an den Rahmenvertrag mit der EU«Ein Abkommen, das den Lohnschutz schwächt, werden wir entschieden bekämpfen»
Kurz bevor der Bundesrat und die EU den neuen Rahmenvertrag präsentieren wollen, haben die Unia-Delegierten ihre roten Linien definiert. In einem Manifest halten sie fest, dass sie beim Schutz der...